Workshop AktivbürgerInnen - Bürgerinitiativen am 8. April 2013, 18 – 20.30 Uhr, Jugend- und Familiengästehaus
Ca. 45 Personen nahmen am Workshop teil
Bernhard Possert (Moderation/externe Prozessbegleitung), Timo Köhler (Referat für BürgerInnenbeteiligung), Hilde Zink (Referat für BürgerInnenbeteiligung)
Diese Zusammenfassung soll einen Überblick über die Bandbreite der geäußerten Meinungen und Anliegen im Workshop geben. Zur besseren Übersicht wurden die Wortmeldungen inhaltlich zusammengefasst und geordnet.
Negative und positive Erfahrungen:
- Öffentliche Veranstaltungen finden oft nur auf Druck von BürgerInnen statt
- Politische Zusagen haben oft keine Bedeutung und werden oft nicht eingehalten
- Stadt Graz steht bei Projekten meist auf der Seite der Investoren
- Als Nachbar wird man nicht zu Verhandlungen eingeladen
- Kaum Antworten von der Verwaltung bei Anfragen Anfragen werden als lästig empfunden
- In den 70-iger Jahren fanden Diskussionen auf Bezirksebene und Sprengelebene statt, die Ergebnisse wurden nicht verwertet
- Negative Erfahrungen bei Terminanfragen an das Bürgermeisteramt
- Probleme werden nicht gehört
- Negative Erfahrungen im Beteiligungsprozess „Rudersdorf und bei den „Dichtedialogen" in Puntigam und Straßgang Andreas-Hofer-Platz/auch PendlerInnen und NutzerInnen hätten einbezogen werden müssen
- Verfahrensabläufe, Verfahren werden ausgelassen/Aufsichtsbehörde Gemeinderäte verlieren oft den Kontakt zur Basis
- Probleme mit Bauverfahren Verschiedene gesetzliche Ebenen (Bund, Land, Stadt) überfordern Bevölkerung
- Positive Erfahrungen mit dem Forum „Mehr Zeit für Graz" und dem Beirat für BürgerInnenbeteiligung
- Annenstraße war ein gutes und umfassendes Projekt, Beteiligung von Interact (Befragungen aller Beteiligten, Straßentheater) war positiv
- Vito-Projekt in St. Peter war beispielhaft, viele Interessierte haben sich beteiligt, das Nachbarschaftszentrum ist entstanden
- Zeit für Graz: 320 Projekte wurden bearbeitet, 80 % davon wurden behandelt, teilweise umgesetzt oder sind in Arbeit
Allgemeine Fragestellungen und Anregungen:
- Wem gehört die Stadt? Den Menschen, die darin leben oder den Investoren? Grundsätzliche Auseinandersetzung mit dieser Frage notwendig
- Leistbare Wohnungen schaffen in lebenswerter Umgebung
- Amtsgeheimnis muss aufgehoben werden
- Mehr Förderung von kleinen Bürgerinitiativen und BürgerInnennetzwerken
- Referat für BürgerInnenbeteiligung mit mehr Ressourcen ausstatten
- Verwaltung und Politik müssen zur Anfragebeantwortung innerhalb einer Frist verpflichtet werden Beschwerdemanagement wichtig - Leitfaden für Beschwerdemanagement erstellen
- Einrichtung einer zentral kompetenten Anlaufstelle für Anliegen, Wünsche, Beschwerden von betroffenen BürgerInnen
- In der Bau- und Anlagenbehörde (besonders), aber auch in anderen Verwaltungseinheiten, die Bescheide ausstellen, ist eine Institution einzuführen, die die Einhaltung von Rechtsvorschriften und Verordnungen in Bescheiden prüft
- Bei der Privatisierung städtischer Betriebe bzw. Aufgaben muss darauf geachtet werden, dass der/die Bürger/in nicht sein/ihr Mitsprachrecht verliert
BürgerInnenbeteiligung bei Planungsprozessen:
- Bedürfnisse der Menschen abfragen, passen oft mit den Entscheidungen der Politik nicht zusammen BürgerInnenbeteiligung als Chance zu positiven und lebenswerten Entwicklung der Stadt sehen
- Lokales Wissen ist realitätsnäher Akzeptanz von BürgerInnenmitarbeit erhöhen
- Nicht nur Information, sondern echte Beteiligung
- Systemisches Konsensieren sollte wegen seiner konfliktlösenden Wirkung als Basis der Kommunikation, Ideenentwicklung, Entscheidungsfindung eingesetzt werden
- Mobile Bürgerbüros, die vor Ort kommen, flexibler agieren können - seitens der Stadt Öffentlichkeitsarbeit verbessern, Einladung verbessern, 2 bis 3 Informationstermine anbieten
- Regelmäßige öffentliche Veranstaltungen zur Information, Diskussion, etc.; Austausch z.B. im Bürgerforum, Stadtforum mit Behörden, Politik,....
- BürgerInnenbeteiligung sollte bei Parks, Kinderspielplätzen, Bezirkssportplätzen stattfinden: Wo und in welcher Größe werden diese angelegt und wie werden sie gestaltet? Veranstaltungen sollten in diesem Fall Kinder und Jugendliche geeignet ansprechen z.B. in Schulen und Jugendzentren
- BürgerInnenbeteiligung benötigt ein Budget
Wie und welche Information soll angeboten werden?
- Rechtzeitige und umfassende Information
- Verschiedene Kommunikationsmittel verwenden, um möglichst viele Menschen und Stakeholder zu erreichen
- Lesbare und verständliche Informationen, Anschreiben, Einladungen in denen Fachbegriffe vermieden oder erläutert werden Transparenz, d.h. alle für ein Projekt wesentlichen Informationen für BürgerInnen zugänglich machen; auch Offenlegung von Verträgen der Stadt mit Privaten
Welche Gruppen sollen eingebunden werden?
- Alle Betroffenen einbinden
- Unmittelbar Betroffene befragen und miteinbeziehen
- Ist BürgerInnenbeteiligung nur die Einbeziehung der schon aktiven BürgerInnen? Methoden, um alle zu erreichen und Interesse wecken; denn sind die Meinungen der AktivbürgerInnen wirklich die Meinungen von allen - oder nur von denen, die am lautesten schreien?
- Wie kann man sicherstellen, dass alle Betroffenen an Beteiligungsverfahren auch teilnehmen und nicht erst nach Prozessende das Ergebnis kritisieren?
- Betroffene Bezirksvertretungen und Bürgerinitiativen vor Ort sollen in Beteiligungsverfahren einbezogen werden Junge und alte Menschen, MigrantInnen miteinbeziehen
Wie und wo sollte ein Beteiligungsprozess ablaufen?
- Gleichwertige Gesprächspartnerschaft im Diskurs zwischen Behörden, Politik, Fachexperten
- Aufrichtige Dialoge auf der Basis von Eckpunkten einer Planung Kurze und überschaubare Prozesse sind wünschenswert
- Ablauf eines Beteiligungsverfahrens übersichtlich und zeitnah
- Ergebnisoffene Prozesse, in denen ein Dialog möglich ist und nicht nur Information Es muss auch möglich sein, dass am Ende eines Prozess steht, dass etwas nicht möglich ist
- Im Konfliktfall ist ausreichende Zeit für eine Befassung nötig BürgerInnenbeteiligung muss in den Bezirken stattfinden; Veranstaltungen dezentral anbieten
Wie sollte mit Ergebnissen umgegangen werden?
- Rückkopplung ist notwendig, was mit den Inputs der BürgerInnen geschieht
- Eine rasche Umsetzung von Ergebnissen aus BürgerInnenbeteiligungsverfahren sollte erfolgen, sonst entstehen Enttäuschungen Umsetzungssicherheit der Ergebnisse BürgerInnenanliegen dürfen nicht in der Schublade verschwinden Menschen, die sich in Beteiligungsprozessen eingebracht haben, sollten in den nachfolgenden Verfahren als Partei anerkannt werden
Leitlinien für die BürgerInnenbeteiligung:
- Leitlinien müssen verbindlich sein Sanktionierungsmöglichkeit für Nichteinhaltung der Leitlinien Projekte im Grünraum einbeziehen Empfehlung: Geltungsbereich erweitern für Planungen betreffend Grünraumausstattung (Spielflächen, Sportflächen)
- Leitlinien sollten auch kleinere Projekte einbeziehen (z.B. Rettenbachklamm), wenn Bedarf von Interessierten/Betroffenen geäußert wird
- Portfolio mit Beteiligungsinstrumenten (auch kurzfristig einsetzbare) sollten in den Leitlinien enthalten sein
- Leitlinien sollen allgemein verständlich und übersichtlich sein
- Beteiligungsmodelle für Großprojekte definieren
- Leitlinien sollen Klarheit schaffen, wer im Beteiligungsprozess welche Rolle spielt
Bezirksdemokratie:
- Bezirksdemokratie stärken/Aufwertung der Bezirksvertretungen
- Mehr Kompetenzen auf Bezirksebene
- Eine lokale Entscheidungskompetenz (Bezirksvertretungen) sollte es bei definierten Themenbereichen (z.B. Verkehr,...) geben, die der Gemeinderat nicht überstimmen kann
- Bezirkspolitik hat teilweise wenig Kontakt zu Bürgerinitiativen, es sollte eine stärkere Vernetzung geben Bezirksdemokratie in Beteiligungsprozessen miteinbeziehen
Bürgerinitiativen:
- Bessere Vernetzung der Bürgerinitiativen zu den Bezirksvertretungen, zum Gemeinderat und der Regierung, in die Beamtenstrukturen - daraus Antwortpflicht
- Bürgerinitiativen/aktive BürgerInnen sollen/müssen zu Konsensfindung bereit sein.
- Rechte und Pflichten für AktivbürgerInnen um gemeinsam eine Lösung zu erzielen. Nicht „nur" dagegen sein. Bürgerinitiativen und AktivbürgerInnen sollen auch das Recht haben im Gemeinderat zu sprechen
Kommunikations- und Treffpunkte für BürgerInnen:
- Örtlichkeiten als Gemeinwesen-Räumlichkeiten anbieten, in denen Information, Diskussion und auch BürgerInnenbeteiligung bei Planungen stattfinden kann
- Anregung: Am Europaplatz im Erdgeschoß BürgerInnen-Planungswerkstatt einrichten; könnte auch von Projektgruppen genutzt werden Nutzung, Stärkung und zweckgebundene Finanzierung dezentraler, lokaler Strukturen (Stadtteilzentren)
Beirat für BürgerInnenbeteiligung:
- Statuten des Beirates dahingehend ändern, dass bei der nächsten Wahl eine breitere Basis geschaffen werden kann Empfehlung: Klärung der Kompetenz des Beirates, verpflichtende Verankerung in der Stadtverfassung, Anhörungspflicht mit Mindestterminen
- Der Beirat für BürgerInnenbeteiligung sollte als System und nicht als Institution gesehen werden
- Stärkung des Beirates für BürgerInnenbeteiligung
- Statutenweiterentwicklung des Beirates für BürgerInnenbeteiligung
- Der Beirat für BürgerInnenbeteiligung sollte Fachexpertisen erstellen (zu welchem Zeitpunkt soll beteiligt werden bzw. welche Methode wäre gut)
- Der Beirat ist kein „Ersatzgemeinderat"
Bau allgemein:
- Broschüre mit verständlich erklärten Verfahrensabläufen, soll BürgerInnen zur Verfügung gestellt werden
- Öffentliche Debatten über Bauvorhaben führen Kritik am Baugesetz (Landesgesetz) in Bezug auf die Nachbarrechte „Ortsüblichkeit" wird in Graz übergangen Verdichtungen minimieren/Dichteüberschreitung bedeutet für AnrainerInnen meist Wertminderung ihrer Liegenschaft
- Entwicklungsplan muss überarbeitet werden. Die (teils zu geringen) Dichten sind nicht konform mit sinnvoller Entwicklung. Manchmal umgekehrt
- Öffentliche Präsentation und BürgerInnenbeteiligung bei Bauvorhaben in sensiblen Bereichen (Altstadt, Villenviertel, Gründerzeit, Vorstadt mit Dorfcharakter etc. )
- Bei baulichen Maßnahmen Informationen (geografisch und inhaltlich) weiter streuen
- Verständliche Erklärung von Einspruchsmöglichkeiten
- Großzügigere Fristen
Bebauungsplanung:
- Bebauungsplanpflicht für das gesamte Stadtgebiet wäre denkbar und theoretisch möglich
- Bebauungspläne sollten durch die Stadt vorausschauend erstellt werden - nicht nur anlassbezogen
- In der Bebauungsplanung werden festgelegte Dichten überschritten
- Bebauungsplan Oeverseegasse ist ein positives Beispiel, für ein verträgliches Ergebnis nach einem längeren Dialogprozess mit professioneller Begleitung und in Kooperation mit der Bezirksvertretung
- Beantwortung von Einwendungen erfolgt erst nach dem Beschluss des Gemeinderates über einen Bebauungsplan. Antworten auf Einwendungen vor der Beschlussfassung, dann Ingangsetzung eines echten Dialoges
- Jeder Einwand muss aufgelistet werden, vom Gemeinderat behandelt und beantwortet werden
- Bebauungspläne einschränken, wenn Bäume geopfert werden müssten
- Projektgruppen einrichten, wie z.B. in Rotterdam, in denen BürgerInnen die Mehrheit gegenüber BeamtInnen haben; erst bei Opposition der BürgerInnen gegenüber BeamtInnen schaltet sich Planungspolitik ein.
Plandarstellungen:
- Pläne im Maßstab 1:1000 sind notwendig, dies ist jedoch derzeit nicht im Raumordnungsgesetz verankert
Stadtbudget/Gebühren:
- Das Budget der Stadt Graz muss für BürgerInnen transparent sein; es muss dafür verständlich aufbereitet werden
- Es sollte Budgetposten geben, für deren Verwendung BürgerInnen verantwortlich sind (vgl. Bürgerhaushalt) Gebührenerhöhungen sollten vorher von BürgerInnen diskutiert werden
Erhaltung alter Bausubstanz/Denkmalschutz:
- Zerstörung des Stadtbildes durch Abriss alter Bausubstanz
- Bei denkmalgeschützten Häusern muss bei Abrissvorhaben eine rechtzeitige Information für BürgerInnen zugänglich sein
- Es ist schwer, alte Gebäude zu erhalten, da die Auflagen für die Erhaltung eine zu hohe Anforderung darstellen Grundsätzliches Abbruchverbot für alle Gebäude, die vor 1945 errichtet wurden
- Der Abriss von Häusern erfolgt ohne Information der AnrainerInnen. Es folgt eine Nachverdichtung
- Keine Abbruchgenehmigungen bevor nicht Bauplanungen (Bebauungsplan oder Bauansuchen) vorliegen; öffentliche Präsentation vor Abbruch in sensiblen Bereichen
Grünraum, öffentlicher Raum:
- Bewusstseinsbildung für den Grünraum der Stadt
- Vor dem Hintergrund der Feinstaubproblematik muss der Baumerhalt im Stadtgebiet Priorität haben (binden CO2) Grünflächen in der Stadt schützen Nutzungsmöglichkeiten von öffentlichen Räumen nicht über Gemeinderat (z.B. Verbote) definieren, sondern in öffentlichen Workshops mit AnrainerInnen und allen potentiellen NutzerInnen diskutieren Leerstandnutzung/Zwischennutzung von Gebäuden und Grundstücken: Die GBG soll offen legen, welche Grundstücke und Immobilien längere Zeit frei stehen Leerstandnutzung z.B. durch Initiativen oder kreative Zwischennutzung von Grundstücken durch BürgerInnen
BürgerInnenbefragungen und -Abstimmungen:
- Missbrauch von direkter Demokratie muss verhindert werden
- Bei BürgerInnenbefragungen ist objektive Vorabinformation notwendig
- Es braucht im Vorfeld Meinungsbildungsprozesse BürgerInnenbefragungen bei kleineren und größeren Projekten
Erstellung der Zusammenfassung: Referat für BürgerInnenbeteligung buergerbeteiligung@stadt.graz.at
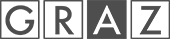
 Termine, Veranstaltungen, Projekte
Termine, Veranstaltungen, Projekte