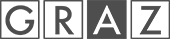GRAZ SIND WIR ALLE
Unter diesem Titel möchte die Stadt Graz Menschen, die in Graz leben und arbeiten, porträtieren und die Vielfalt von Graz sichtbar machen.
Jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. Der Autor Joachim Hainzl und die Fotografin Maryam Mohammadi haben sich im Auftrag der Stadt Graz auf den Weg gemacht, um Menschen in Graz zu begegnen und ihre Geschichten einzufangen. In Form von Erzählungen und Bildern geben sie Einblicke in Lebensgeschichten von Menschen, die mit Graz auf unterschiedliche Weise verbunden sind.
Begonnen haben die beiden im äußeren 17. Grazer Bezirk Puntigam und sind nacheinander von Bezirk zu Bezirk mit unterschiedlichen Menschen ins Gespräch gekommen.
Die hier präsentierten Lebensbilder bieten einen ganz persönlichen Einblick in das Leben von Menschen, die Teil der Grazer Bevölkerung bilden und auf diese Weise Graz in all seiner Vielfalt und Individualität sichtbar und spürbar machen.
XENOS - Verein zur Förderung der soziokulturellen Vielfalt
verein-xenos.net



Seit dem Jahr 2015 arbeitet der in Ägypten aufgewachsene Amir Istfanous als Projektleiter bei der GBG (Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH), einem Unternehmen der Stadt Graz mit Sitz in der Neutorgasse. In den letzten 10 Jahren leitete er mehr als zehn von der Stadt beauftragte Schulbauprojekte. Neben der Volksschule in Reininghaus und der Mittelschule in Puntigam betreut er aktuell den Bau der Mittelschule in der Smart City. Dort treffen wir ihn in seinem beheizten Baucontainer zum Gespräch, da er, wie er selbst meint, seiner Arbeit lieber vor Ort und nicht vom Büro aus nachgeht.
Angekommen an einem Faschingsdienstag
Nachdem er in Ägypten studiert und jahrelang im Wohn- und Industriebau gearbeitet hatte, wollte er international Karriere machen. Doch mit seinen Wunschländern sollte es nicht klappen. Auf Empfehlung von Freunden bewarb er sich in Österreich und kam schließlich am 7. Februar 1989, einem Faschingsdienstag, in Graz an. „Das war für mich der erste Kulturschock. Ich bin tief christlich erzogen worden und ich dachte mir: ,Mein Gott, was ist denn da los? Da habe ich nichts verloren, ich kehre wieder zurück nach Ägypten!‘" Letztendlich blieb er da, weil vieles seinen Vorstellungen entsprach, wie etwa die Ordnung im Verkehr oder die Sauberkeit. Istfanous erzählt stolz, dass er sich Deutsch vom ersten Tag an selbst beibrachte. Dabei half ihm, als koptischem Christen, eine Bibel in Arabisch mit deutscher Übersetzung.
Nicht immer nur positive Erlebnisse als Zeitungsverkäufer
Da sein Studium in Ägypten in Graz anerkannt wurde, konnte er in Graz weiterstudieren, musste aber den einjährigen Vorstudienlehrgang zum Erwerb der deutschen Sprache positiv abschließen. Im Lehrgang waren Studierende aus vielen Ländern, „und die einzige Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren, war die deutsche Sprache." Das Geld für den Lebensunterhalt und sein Zimmer in der Vinzenz-Muchitsch-Straße verdiente er sich mit dem Verkauf und Austragen von Zeitungen. Seine Deutschkenntnisse waren damals noch nicht perfekt; um die meisten rassistischen Vorfälle als solche zu entlarven, bedurfte es dieser aber auch gar nicht. So erinnert er sich, dass einmal in der Straßganger Straße ein Autofahrer stehen blieb, um von ihm eine Zeitung zu kaufen. Statt dem Geld streckte der Autofahrer ihm jedoch den Fuß entgegen und meinte, dass das alles sei, was er bekomme. Rassistische Bemerkungen erlebt er bis heute. Und ignoriert sie, trotz guter Deutschkenntnisse, meistens. Manchmal aber sagt er auch seine Meinung.
Große Unterstützung durch seine Frau
Zur Stütze während seines Studiums wurde seine spätere Frau, die er im Frühjahr 1990 in einer christlichen Gemeinschaft kennengelernt hatte. (Kopt:innen hatten damals in Graz noch keine eigene Kirche.) Aufgrund der medialen Klischeebilder über europäische Frauen, die als lasterhaft und untreu galten, waren seine Eltern in der ägyptischen Heimat zuerst gegen eine Eheschließung. Schließlich fand diese im Sommer 1991 aber in Ägypten statt, unter den Hochzeitsgästen auch 18 Kärntner Verwandte seiner Frau. Durch die Ehe wurde die finanzielle Situation leichter, wobei, „ich habe immer darauf geachtet, dass ich mein eigenes Geld verdiene." So trug er weiter Zeitungen aus, „von ein Uhr in der Nacht bis sechs Uhr in der Früh." Dann kam er nach Hause, frühstückte und ab 8.00 Uhr ging es zum Studium auf die Universität. Am Nachmittag lernte er und erst dann kam er zum Schlafen. „Das habe ich wirklich so diszipliniert gemacht, fünf Jahre lang, bis ich mit dem Studium fertig war."
Als Ägypter zur Sponsion, als Österreicher zum Bundesheer
Für Istfanous war es wichtig, sein Studium als Ägypter zu absolvieren. „Mein Ziel war es, dass man sagt - wenn ich aufstehe bei der Sponsion - dass der Ägypter es geschafft hat. So war es dann auch." Unmittelbar nach dem Studienabschluss 1995 suchte er um die österreichische Staatsbürgerschaft an und in einer heute undenkbar kurzen Zeit von zwei Monaten war das Verfahren abgeschlossen. Als Österreicher bekam er als 34-Jähriger bald darauf die Einberufung zum Bundesheer.
Äußerst schwierig hingegen war es, als in Österreich ausgebildeter Akademiker einen Job zu bekommen. „Ich habe 320 Bewerbungen geschrieben, aber niemand nahm mich auf!" Eine Firma meinte: „Sie sprechen gut Deutsch. Aber ich kann Sie mit Ihrer Hautfarbe nicht aufnehmen." Andere verwendeten Ausreden und meinten, dass er sich mit der Geografie Österreichs nicht auskennen könne, da er nicht hier geboren worden sei. Als er zu einem Vorstellungsgespräch in Klagenfurt eine Broschüre über den von ihm geplanten und durchgeführten Bau des ersten koptischen Kirchenraums in der Grazer Grabenstraße mitbrachte, bekam er den Job. Mit der ersten von ihm betreuten Baustelle (einem Diagnostikzentrum in Graz) konnte er sich bestätigen und es folgte eine erfolgreiche Zeit in Kärnten.
Die inzwischen angewachsene Familie zog schließlich von den Kärntner Schwiegereltern zurück nach Graz, wo sie ganz in der Nähe seines neuen Arbeitgebers ein kleines Haus für sich fand. Für diesen internationalen Grazer Konzern war er die kommenden 14 Jahre auf mehreren Kontinenten beruflich tätig.
Fachhochschullehrender und erfahrener Projektleiter von Schulhausbauten
2014 trat Istfanous seine Stelle am Institut für Bauplanung und Bauwirtschaft auf der Grazer Fachhochschule Joanneum an. Seit fast einem Jahrzehnt ist er zudem bei der GBG beschäftigt. Dort konnte er, dessen Eltern in Ägypten selbst Volksschulen leiteten, bei der Errichtung von Schulbauten viele Erfahrungen sammeln: „Seit 2013 verfolgt man das neue Konzept der sogenannten Clusterschule", das sich, nach Rückmeldung von Pädagog:innen, auch in Graz bewährt. So gibt es neben den Klassenzimmern eine Lernzone, um durch eine offene Bauweise auch eine offene Lernweise zu unterstützen. Die eigentliche Arbeit von Istfanous beginnt, wenn nach einem vorgegebenen Raum- und Funktionsprogramm der Architekturwettbewerb abgeschlossen wurde. „Mit der Kostenerstellung für die Entwurfsphase tritt man an den Stadtrechnungshof heran, der auf Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit prüft."
Nach Fertigstellung einer Schule, wie etwa der im September 2024 eröffneten 20-klassigen Volksschule in Reininghaus, geht die Arbeit von Istfanous weiter: „Im Bauwesenbereich gibt es eine Gewährleistung für drei3 Jahre. Das heißt, wir müssen immer schauen, dass alles so funktioniert, wie wir das ausgeschrieben, geplant und abgewickelt haben."
Bemerkt Istfanous Unterschiede in der Arbeitsweise von heute zu früher? „Die Jungen, die kennen sich mit dem Digitalen gut aus", mit Homeoffice und Videokonferenzen. Er vertraut jedoch weiterhin jenen Plänen, die ausgedruckt sind und nicht nur am Bildschirm angesehen werden. Eher unüblich sei es auch, dass er sich, zusätzlich zur örtlichen Bauaufsicht, oft an der Baustelle aufhält. „Aber wenn Probleme auftauchen, bin ich immer vor Ort und weiß, worum es geht."
Die Förderung des öffentlichen Verkehrs
Mit der Neutorgasse, wo im Umfeld seines Büros eine neue Straßenbahntrasse verlegt wurde, ist er inzwischen sehr zufrieden, da dadurch die Qualität des Innenstadtbereichs erhöht worden sei. Er selbst versucht, im Arbeitsalltag möglichst autounabhängig zu sein. Es kommt aber öfter vor, dass doch mit dem Auto gefahren wird, um Zeit zu sparen. Die Effizienz soll auf jedem Fall nicht darunter leiden. Die Förderung des öffentlichen Verkehrs sehe man, so Istfanous, ebenfalls bei den neuen Schulbauten. Sie alle haben eine nahe gelegene Bus- oder Straßenbahnhaltestelle, während Parkplätze (etwa für Lehrer:innen) nachrangig behandelt wurden.
Brückenbauer zwischen den Religionen
Beim Umbau eines leerstehenden Gebäudes, das 2004 in der Wiener Straße als koptische Kirche für die stark angewachsene Religionsgemeinschaft eröffnet wurde, konnte Istfanous in unzähligen Stunden ehrenamtlicher Arbeit sein fachliches Knowhow einbringen. Ihm war es dabei wichtig, von Beginn an die Nachbarschaft einzubeziehen: „Als wir eingezogen sind, habe ich ein Infoblatt ausgeteilt und erklärt, wer wir sind. Wir müssen auch Teil der Gesellschaft sein und dürfen uns nicht abkapseln." Als 2018 in der Hafnerstraße eine Lagerhalle in eine weitere koptische Kirche umgebaut wurde, gab es anfangs einige Schwierigkeiten, etwa wegen der Parkplatzsituation. Aber, so Istfanous, in solchen Situationen müsse man sich zusammensetzen und miteinander reden. „In der Hafnerstraße ist mir sogar gelungen, dass wir eine Kirchenglocke bekommen, was normalerweise sehr schwierig ist in Graz."
Bereits vor den Kirchenbauten war er im Grazer interkonfessionellen Arbeitskreis und später jahrelang im Ökumenischen Forum und interreligiösen Beirat der Stadt Graz aktiv. Istfanous betont, dass er sich immer als Brückenbauer zwischen den Religionen verstand. So hielt er vehement dagegen, wenn politische Parteien versuchten - etwa bei Plänen zum Bau von Moscheen - die koptische Gemeinschaft in Graz gegen andere Religionsgemeinschaften aufzuhetzen. „Ich habe gesagt, ich werde nicht etwas machen, worunter wir Kopten selbst in Ägypten gelitten haben."



Nayari Castillo-Rutz wurde im Jahr 1977 in Caracas, der Hauptstadt Venezuelas, geboren: „Es ist eine sehr große und gewalttätige Stadt. Man muss daher schnell erwachsen werden. Gleichzeitig ist sie sehr kosmopolitisch, mit Einflüssen aus der ganzen Welt."
Groß geworden in einem politisierten Umfeld
Castillo-Rutz entstammt einer erfolgreichen Akademiker:innenfamilie. Das politisch und sozial aktive Umfeld brachte einige Vorteile, wie sie sich heute erinnert: „An einem Tag konnte ich vormittags meine Mutter bei ihrer Sozialarbeit im Armenviertel begleiten, mich zu Mittag im Umfeld der Präsidentenfamilie bewegen und am Abend ein Literaturfest besuchen." Ebenso aufregend waren die von ihr besuchten Schulen: „Ich bin in einer sozialistischen Schule aufgewachsen, wo wir den Geburtstag von Tito, dem damaligen jugoslawischen Präsidenten, gefeiert haben. Danach war ich in einer französischen Schule, wo es um Menschenrechte ging."
Doch sie rebellierte als Jugendliche, indem sie viel Sport trieb, ihr Molekularbiologiestudium erfolgreich abschloss und in die Forschung ging. Nebenbei künstlerisch tätig, fing sie noch während ihres naturwissenschaftlichen Studiums an, an jener Universität Kunst zu studieren, an der ihre Mutter damals Vizerektorin war.
Raus in die Welt
Im Jahr 2004 graduierte sie im Bereich der Zeitgenössischen Kunst. Ihre Ausstellungen waren von Erfolg gekrönt; sie gewann sogar einen wichtigen Staatspreis - und das als die zweite Frau in sieben Jahrzehnten. Castillo-Rutz: „Eine sehr gute Freundin hat mir da gesagt: ,Du musst in die weite Welt, damit du dich entfalten kannst!‘" Dazu kam, dass sie die Politik von Hugo Chavez stets ablehnte, der 1999 in Venezuela als Staatspräsident an die Macht gekommen war: „Ich empfand dessen Militarisierung als sehr verdächtig, da ich eine überzeugte Antimilitaristin bin und Autoritarismus nicht akzeptieren kann."
Neben einer Karriere als Videofilmerin widmete sich Castillo-Rutz der Konservierung und Restauration von analogen Filmrollen. Dabei kam ihr das Wissen aus ihrem Biologiestudium zugute. Aufgrund ihrer Expertise betraute man sie am deutschen Goethe-Institut in Caracas mit der Restaurierung der dort gesammelten deutschsprachigen Filme. Castillo-Rutz: „Ich habe dort österreichische und deutsche Filme gesehen und so ein bisschen Deutsch gelernt!" Als sie sich entschied, ins Ausland zu gehen, war für Castillo-Rutz das Ziel daher klar: Deutschland. Sie selbst sagt dazu: „Ich dachte, dass die Mentalität gut zu mir passt und es ein großartiges Land mit viel Kunst und Kultur ist."
Zum Studieren nach Deutschland
So bekam Castillo-Rutz im Jahr 2004 die Chance, als 27-Jährige mit einem Stipendium des „Deutschen Akademischen Auslandsdiensts" in Deutschland zu studieren. Neben dem Erlernen der Sprache stellte anfangs vor allem das deutsche Wetter eine große Herausforderung für sie dar: „Vorher lebte ich in einem Land mit einer paradiesischen Temperatur zwischen 20 und 28 Grad Plus." Im Gegensatz dazu erschien ihr das ostdeutsche Weimar, wo sie ihr Masterstudium zu Kunst im öffentlichen Raum absolvierte, wie der kälteste Punkt Deutschlands. Auch sonst empfand sie als Ausländerin den Empfang eher frostig: „Ich habe dort die Lebensart der Ostdeutschen kennengelernt. Es gibt immer noch eine große Unzufriedenheit über die Vereinigung mit der BRD und zum anderen eine weitverbreitete Ausländerfeindlichkeit."
Geblieben der Liebe wegen
Ihr Plan, nach ihrem inzwischen begonnenen Doktoratsstudium wieder nach Venezuela zurückzukehren, um dort eine universitäre Karriere einzuschlagen, zerschlug sich, als Castillo-Rutz den Deutschen Hanns-Holger Rutz kennen und lieben lernte. Er arbeitete damals in Weimar als Soundartist und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Musikhochschule. Im Jahr 2008 wurde geheiratet, etwas später ging man nach England, wo Rutz sein Doktorat abschloss.
Während ihr Ehemann in England also seinem Studium nachging, lernte Castillo-Rutz durch Künstler:innenresidenzen weitere europäische Städte kennen. Da sie durch ihre Mutter, die lange Jahre in den USA gelebt hatte, auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt, habe sie „eigentlich relativ viel Bewegungsfreiheit. Ich kann mit dem venezuelanischen Reisepass in Länder reisen, wo viele nicht hin können, und mit dem US-amerikanischen Pass zum Rest der Welt." Im Jahr 2010 kam sie für einige Monate in das Grazer Rondo, „wo man damals über ein Programm des Landes Steiermark ein künstlerisches Atelier bekommen konnte". Nach ihren rassistischen Erfahrungen in Ostdeutschland empfand sie Graz als Erleichterung: „Ich erinnere mich, am dritten Tag oder so, da fühlte ich, dass ich, sozusagen, keine Maske trage. Ich konnte sein, wie ich bin, und konnte meine politische Meinung äußern, ohne attackiert zu werden!"
Eine Vielzahl von Aktivitäten
Nach dem Abschluss des Doktoratsstudiums von Hans-Holger Rutz entschied sich das Paar im Jahr 2012, von England nach Graz zu ziehen. Innerhalb kurzer Zeit konnte sich Nayari Castillo-Rutz in Graz, durch die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Kunst- und Kultureinrichtungen, als umtriebige und aktivistische Künstlerin erfolgreich etablieren. Daneben gründete sie zusammen mit anderen migrantischen Künstlerinnen in Graz die Gruppe „daily rhythms collective". Über viele Jahre blieb sie außerdem der TU Graz als Lehrbeauftragte und wissenschaftliche Projektmitarbeiterin verbunden. Castillo-Rutz: „Ich habe dann an der FH Joanneum den Master in Projektmanagement gemacht und fing an, als Projektleiterin in EU-Projekten zu arbeiten", unter anderem für zwei Jahre im Transkulturellen Zentrum des Vereins „Omega". Neben einem Multiplikator:innenprojekt leitete sie das Projekt „Mut Machen", das junge Frauen im Bereich der Gewaltprävention unterstützte. Stolz zeigt sie uns das Buch, das zum Projekt entstand.
Neben dem Umstand, dass ihr Arbeitgeber die Arbeit des Vereins einstellte, war Castillo-Rutz in dieser Zeit persönlich durch eine mittlerweile gut überstandene Krebserkrankung sehr belastet. Dennoch begann sie wieder, an der TU Graz zu arbeiten, und gründete, zusammen mit ihrem Ehemann, um 2017 den Kunstverein „Reagenz", inklusive Kunstraum in der Morellenfeldgasse. Die Entscheidung für ihre Wohnung, die ebenfalls im Herz-Jesu-Viertel liegt, sei vom Ehepaar gut durchdacht gewesen: „Mein Mann Hanns-Holger ist eine sehr sensitive Person, was das Hören betrifft. Es sollte darum ein leiser Bezirk sein, der noch in der Stadt liegt" und verkehrstechnisch gut angebunden ist. Dazu sollte die Altbauwohnung zwischen den damaligen Arbeitsplätzen an der TU in der Kronesgasse und den Inffeldgründen liegen.
Für eine bunte, anti-identitäre Gesellschaft
Gibt es etwas, dass ihr hier im Vergleich zu ihrer Heimatstadt Caracas fehlt? Castillo-Rutz: „Ich vermisse mein multidisziplinäres und multikulturelles Leben dort; eine durchmischte Gesellschaft, wo man in Kontakt mit vielen unterschiedlichen Menschen kommt." Hier sei ihr Leben eher beschränkt auf das universitäre und kulturelle Milieu, auch wenn sie in den letzten Jahren mit vielen ihrer soziokulturell orientierten Projekten und Kooperationen in Graz versucht habe, Barrieren aufzubrechen und für Begegnungsmöglichkeiten zu sorgen. Insofern lehne Castillo-Rutz Begriffe wie jenen des „Kulturkreises" ab und könne auch mit „migrantischen Communities" wenig anfangen: „Ich habe große Probleme, zu sagen, dass ich nur Venezolanerin oder US-Amerikanerin bin!" Es sei nachvollziehbar, dass Personen mit Migrationshintergrund sich in Gruppen zusammenfänden, um sich zu schützen, aber „wir sollten eine multikulturelle Gesellschaft anbieten, wo es mehr Farben, Ideen und Interessensgruppen gibt. Ich bin total gegen eine Identität im Sinne nationalsozialistischer Ideen."
Als ausländische Grazerin ausgeschlossen von politischer Teilnahme
Auch sie persönlich habe in Graz wiederholt Rassismus erlebt, obwohl: „Ich habe ein Studium, beherrsche die Sprache, habe keine Aufenthaltsprobleme. Ich kann kämpfen und bin in einer Position, etwas sagen zu können. Trotzdem habe ich auch Angst!" Unzufrieden macht Castillo-Rutz die fehlende Möglichkeit, in Österreich wählen zu können. Obwohl sie sich inzwischen schon als Grazerin fühlen würde, könne sie als Nicht-EU-Ausländerin in Graz nur den Migrant:innenbeirat wählen, der jedoch keine Möglichkeit hätte, Dinge wirklich zu ändern.
Sie habe Österreich für ihr Leben gewählt, weil sie in einer Demokratie leben möchte. Die stark anwachsende Ausländer:innenfeindlichkeit empfinde sie deshalb als sehr bedrohlich: „Wenn es um Migrant:innen geht, habe ich oft gehört, was wir alles nehmen - aber nicht, was wir alles geben! Wir sind Menschen mit einem Reichtum an Ideen und Lösungen, wir sind eine Bereicherung für die Stadt!"



Seit einigen Jahren besteht in der Geidorfer Wastlergasse 2 das Nachbarschaftszentrum der 2015 gegründeten Grätzelinitiative Margarethenbad. Es entstand aus einer Bürger:inneninitiative zur Rettung des Margaretenbades unter der Federführung von Claudia Beiser. Hier treffen wir an ihrem 43. Geburtstag die dort seit Mai 2024 beschäftigte Susanne Sattmann, die für die Organisation und Betreuung des Grätzeltreffs verantwortlich ist und uns aus ihrem bewegten Leben erzählt.
Fachschule und Lehre
Aufgewachsen als Kind obersteirischer Eltern in zwei Orten Niederösterreichs, absolvierte die Jugendliche in Wien erfolgreich eine dreijährige Fachschule für soziale Berufe. Sattmann: „Damals war die Schule eine Vorbereitung für die, die Krankenschwestern werden wollten." Danach zog sie mit 18 Jahren nach Wien und begann, da sie gleich arbeiten wollte, eine Lehre als Orthopädieschuhmacherin. Dort, im kleinen Lehrbetrieb, war sie die einzige Frau: „Ich war jung und bin den ganzen Tag in der Werkstatt gesessen mit meinen drei älteren Kollegen." Obwohl sie das Handwerkliche an ihrer Arbeit sehr mochte, wechselte sie just nach der Gesellenprüfung ihren Arbeitsplatz, um ihrem cholerischen Chef zu entgehen. Rasch fand sie eine neue Stelle. Diesmal bei einem jungen Schuhmachermeister: „Er hat ganz andere Materialien verwendet und die Schuhe waren viel leichter. Aber es war nicht mehr dieses schöne alte Handwerk!"
Schuhmacherin und Kindergruppenbetreuerin zugleich
Für Sattmann, die zu dieser Zeit erst Anfang 20 war, stellte sich die Frage, ob sie noch studieren solle. Dazu hätte sie jedoch die Matura nachmachen müssen. Der damit verbundene Lernaufwand schreckte sie aber ab und so entschied sie sich stattdessen für eine Ausbildung zur Kindergruppenbetreuerin. „Am Anfang sind Kinder schüchtern, aber wenn sie dann auf dich zugehen, ist es lebendig. Die Arbeit ist schön, weil man etwas bewirkt und Veränderungen bei den Kindern bemerkt." Schon als Jugendliche war sie selbst „die Große", die oft auf ihre jüngeren Geschwister aufpasste.
Eine Zeit lang arbeitete sie jeweils 20 Wochenstunden in einer Kindergruppe und im Schuhmacherbetrieb. Als ihr diese Anstrengung schließlich zu viel wurde, kündigte sie zuerst bei der Kindergruppe. „Dann kam ich schnell drauf, dass ich es doch andersrum will und habe beim Schuhmacher gekündigt und in der Kindergruppe weitergearbeitet. Beim Schuhmacher hätte ich sicher besser verdienen können. Man hatte mir sogar eine Gehaltserhöhung angeboten, damit ich bleibe."
Der Liebe wegen nach Graz
Nachdem sie in Wien nochmals ihren Arbeitsplatz gewechselt und in einem Montessori-Kinderhaus gearbeitet hatte, war es schließlich die Liebe, die sie mit 28 Jahren im Jahr 2009 nach Graz brachte: „Der Umzug hat mich ganz schön aus der Bahn geworfen. Obwohl es nicht einmal eine Stadt mit einer fremden Sprache ist, war es schwierig, niemanden zu kennen und keinen richtigen Anschluss zu haben. Studiert habe ich auch nicht, wo man sonst leicht viele Leute kennen lernt." Zudem sei schon in den ersten Monaten nach dem Umzug zu merken gewesen, „dass das mit der Beziehung wahrscheinlich nicht funktionieren kann". Nach der Trennung stellte sie sich wiederholt die Frage, ob sie nach Wien zurückgehen sollte: „Ich habe es überlegt, so als Fluchtgedanke. Dann habe ich mir gesagt: ‚Ok, ein halbes Jahr gebe ich mir jetzt und wenn ich dann noch nach Wien will, dann ziehe ich wieder zurück‘."
Verbunden mit dem Umzug in eine neue Stadt erfolgte mit einer Ausbildung zur Körperarbeit eine weitere berufliche Neuorientierung. Ihr Versuch, sich mit dieser Qualifikation selbständig zu machen, war jedoch nicht von Erfolg gekrönt. „Ich bin gescheitert. Das ganze Drumherum, um das man sich kümmern muss, und auch wie man zu Klient:innen kommt, das war mir schließlich zu viel!" Spätestens mit der Geburt ihrer Tochter war die Frage der Selbstständigkeit dann ganz abgehakt.
Ein Kind als Beheimatung
Auch durch ihre wiederholten Umzüge fühle sie sich, meint Sattmann, relativ wenig beheimatet. „Wobei ich mich mittlerweile am ehesten in Graz zu Hause fühle. Ich mag Wien nach wie vor, aber auch da waren nicht meine Wurzeln." Hingegen sei ihre in der Steiermark geborene Tochter hier sehr verwurzelt, „durch die Schule, Freundinnen und da sie immer in Graz gewohnt hat, wenn auch nicht in derselben Wohnung. Und das gibt mir auch zum Teil Wurzeln. Wir Eltern sind getrennt, aber der Papa ist auch in Graz und so gibt es keinen Grund für mich, wegzuziehen, weil ich es schön finde, dass meine Tochter Wurzeln hat." Dennoch waren für sie als Berufstätige vor allem die ersten Lebensjahre ihrer Tochter eine Herausforderung. Denn weder vom Vater des Kindes noch von ihr lebten Familienmitglieder in Graz, die Betreuungsaufgaben übernehmen hätten können. Sattmann: „Jetzt ist es viel leichter, weil sie größer ist, aber gerade wenn die Kinder klein sind und ständig Betreuung brauchen oder krank sind, ist es wirklich schwierig."
Geprägt durch den Verlust der Mutter
An diesem Punkt des Gesprächs mit Susanne Sattmann wird es plötzlich sehr emotional, als sie uns vom frühen Verlust ihrer Mutter erzählt und wie dieser bis heute nachwirkt. Ihre Mutter starb mit 35 Jahren bei einem Autounfall. Auch die damals kleine Susanne war mit im Fahrzeug. „Dadurch habe ich mein Nest und meine Wurzeln verloren. Es hat mein Leben geprägt." Als sie selbst auf die 35 zuging, wuchs daher die Angst, dass sie nicht älter werden könne als ihre in diesem Alter verstorbene Mutter. Ein Therapeut versicherte ihr damals, dass viele, die solche Verluste erleben, Ähnliches verspüren. Nun, da ihre Tochter in dem Alter sei, in dem Susanne Sattmann den Tod ihrer Mutter miterleben musste, ist wieder eine Unsicherheit da, „dass in diesem Jahr irgendwas passiert, dass sich die Geschichte irgendwie wiederholt."
14 Jahre Arbeit im Kindermuseum FRida & freD
Schon während ihrer Zeit als Selbständige fing sie im 2003 eröffneten Kindermuseum in Graz zu arbeiten an. Neben ihrer Arbeit als sogenannte „Wegbegleiterin", welche den Kindern beziehungsweise Besucher:innen beim Gang durch die Ausstellungen zur Seite steht, war sie eingebunden in Kindergeburtstage. Am meisten gefiel ihr die mehrtägige Sommerbetreuung, da man, so Sattmann, dort die Kinder besser kennenlernen und mit ihnen in Austausch kommen konnte. Nachdem sie zu Hause selbst ihr kleines Kind zu betreuen hatte, wechselte sie später an die Kasse und zur Shop-Betreuung. Inklusive ihrer Karenzzeit waren es schließlich 14 Jahre, in welchen sie im Kindermuseum tätig war.
Drei Damen mit Namen Anneliese
2024 war die Zeit reif für eine neue berufliche Herausforderung. Zum Job hier im Nachbarschaftszentrum, das sie vorher nicht kannte, kam sie zufällig: „Eine Freundin, die auf Jobsuche war, hat gesagt, sie habe einen Job für uns. Wir haben gehofft, da zwei Leute gesucht wurden, dass wir gemeinsam den Job machen. Aber nur ich habe ihn bekommen." Gleich zu Beginn ihrer Arbeit konnte Sattmann ihren Wunsch, intensiv mit Menschen zu arbeiten und mit ihnen in Verbindung zu kommen, bei der Planung des großen Grätzelfests umsetzen: „Da habe ich mit vielen Leuten kommuniziert, die ich nie gesehen hatte, und ein Fest geplant, bei dem ich noch nie war."
Grundsätzlich sei das dreimal in der Woche geöffnete Nachbarschaftszentrum offen für alle. „Wir haben jede Woche einen Italienischkurs und Französisch alle zwei Wochen. Es gibt eine internationale Spielgruppe, eine Literaturrunde und eine Runde, die Olivenöl bewertet und verkostet." Manche Angebote finden hingegen nur einmalig oder einmal im Monat statt, „wie jetzt im Winter ein Kochabend".
Ein wichtiges Ziel ist die Aktivierung von Menschen aus dem Viertel. Die Gespräche mit diesen vielen Ehrenamtlichen, die das Programm des Grätzeltreffs zum Großteil gestalten, sind eine der Hauptaufgaben von Sattmann: „Da den meisten, die im Berufsleben stehen und vielleicht Kinder haben, die zeitlichen Ressourcen fehlen, sind die Ehrenamtlichen zum großen Teil Pensionist:innen."
Susanne Sattmann kann sich sehr gut vorstellen, für längere Zeit im Nachbarschaftszentrum tätig zu sein. „Es ist sehr familiär und Menschen haben hier Wurzeln." Gerade für sie als Mutter sei es zudem äußert entspannend zu wissen, dass sie bei Bedarf bei ihrem Kind zu Hause bleiben oder es hierher mitbringen könne.
Aufgrund ihrer eigenen Familiengeschichte gleichsam magisch gestaltete sich für Sattmann ihr erster Arbeitstag, an dem sie nach der Einschulung allein im Grätzeltreff anwesend war: „Meine Mama hieß Anneliese und ich bin an dem Vormittag mit drei Damen dagesessen, die alle Anneliese heißen. Mittlerweile sind sie meine Stammkundinnen!"



Im Jahr 1992 holte Elif Yalcinkayas Vater, der hier seit den 1980ern als sogenannter „Gastarbeiter" gearbeitet hatte, die vierjährige Elif, drei ihrer Geschwister und ihre Mutter nach Österreich. Da in Jugoslawien Krieg herrschte, war die Reise eine abenteuerliche. Bei einer nächtlichen Rast wurden sie sogar ausgeraubt. Glücklicherweise brachte ein weiterer Reisender die Familie mit seinem Auto bis zum Bahnhof in Spielfeld. Dort sah die kleine Elif das erste Mal Schwarzbrot, das sie zuerst nicht essen wollte, „weil es so verbrannt aussah und sauer schmeckte."
Ein Leben in Keller und Garage
In der Türkei lebte die Familie in einem großen Haus samt Garten. Groß war daher der Schock, als sie mit dem Vater zu dessen Wohnung in einem Hochhaus in Judendorf-Straßengel kamen: „Wir gingen rein und wollten hinaufgehen. Da sagte mein Vater, wohin wir denn gehen. Dann ging es hinunter in seine Kellerwohnung!" Diese bestand aus lediglich zwei Räumen, mit WC und Bad am Gang.
Als die Familie nach einem Jahr umzog, waren die Bedingungen in der neuen Wohnung in Gösting, die eigentlich eine umgebaute Garage war, noch schlechter. Es war damals, so Yalcinkaya, aufgrund des herrschenden Rassismus für Migrant:innen schwierig, überhaupt eine Wohnung zu finden. „Dazu kam, dass die Menschen nicht über ihre Rechte informiert waren. Heutzutage weiß man, wo man sich hinwenden kann, wenn Unrecht geschieht." Da es kaum Berührungspunkte mit der Aufnahmegesellschaft gab, entwickelten sich so innerhalb der „Communities" Hilfssysteme. „Du verstehst mich, ich verstehe dich, wir sprechen die gleiche Sprache" und schon half man sich. Politische und religiöse Unterschiede waren da nebensächlich.
Durch die unzumutbaren Verhältnisse in der Wohnung, in der es massiv schimmelte, kam ihre kleine Schwester mit Asthmaanfällen ins Krankenhaus, wo man den Ursachen der Erkrankung nachging. „Mein Vater hatte uns immer gesagt, wir dürfen nichts sagen, weil das Jugendamt ihnen sonst die Kinder wegnimmt." Aus Angst vor dem Jugendamt durften die Kinder auch nicht draußen spielen. „Wir mussten immer artig und leise sein!" Schließlich meldete Elifs Mutter, ohne Wissen ihres Mannes, die krankmachenden Verhältnisse. „Auf einmal war das Gesundheitsamt bei uns vor der Tür." Sie mussten sofort die Wohnung verlassen und bekamen eine Sozialwohnung (Yalcinkaya: „In dem Haus, wo sich jetzt das Frauenhaus befindet!"). Damit gab es für die Familie zum ersten Mal eine Wohnung mit Luft und Licht. Betreut wurden sie von der Sozialarbeiterin Brigitte Köksal, der späteren ersten Integrationsreferentin der Stadt Graz.
Der „Türke" in der Sporgasse als Trauma
Noch bevor Elif Yalcinkaya in Eggenberg in die Volksschule kam, hatte sie über das ORF-Kinderprogramm Deutsch gelernt: „Jeden Tag, Punkt 12 Uhr, hat meine Mutter mich vor den Fernseher gesetzt und ich habe Konfetti-TV angeschaut." So gab es auch nie Sprachprobleme in der Volksschule. „Die ersten drei Jahre waren super. Aber dann kam im Sachunterricht die Türkenbelagerung." Als einzige Türkin in der Klasse wurde sie nun zum Thema. Bei einem Schulausflug erklärte ihr die Klassenlehrerin in der Sporgasse vor der ganzen Klasse: „Elif, siehst du den Türken? Das ist dein Vorfahre!" Bis heute wirkt dieses traumatische Erlebnis nach: „Ich kann bis heute nicht durch die Sporgasse gehen, ohne zum ‚Türken‘ raufzusehen!"
Mit elf Jahren erstmals als Übersetzerin im Kreißsaal
Da sie in der Volksschule das einzige türkischsprechende Kind war, das gut Deutsch konnte, holte man sie immer wieder in die Schuldirektion zum Übersetzen, wenn türkischsprechende Eltern kamen. In ihrer Klasse nahm man darauf kaum Rücksicht. Während sie zwischen dem Schulpersonal und Eltern vermittelte, fuhr die Klasse mit dem Unterricht fort. Gewartet wurde nicht, sodass sie immer nacharbeiten musste. Dennoch: „Es hat mich geprägt und ich habe das zu meinem Beruf gemacht: Übersetzen, helfen, für einen da sein, Zivilcourage zeigen." Sie wurde bei den Erwachsenen so bekannt für ihre Übersetzungen, dass sie sogar als Elfjährige zum ersten Mal im Kreißsaal des Grazer LKH bei einer Entbindung dabei war. „Hier am Arm habe ich noch die Narbe, wo die Frau mich während der Geburt gebissen hatte! Es war eine Nachbarin, die nach der Geburt nicht noch mehr Kinder haben und sich heimlich sterilisieren lassen wollte. Als Kind verstehst du ja nicht, was eine Sterilisation ist." So sagte sie dem Arzt: „Sie sollen irgendetwas schneiden, damit die Frau kein Kind mehr bekommt!"
Brigitte Köksal als Mentorin
Aus der Hauptschulzeit sind Yalcinkaya positive Diskriminierungen im Gedächtnis geblieben. Obwohl sie beim Schwimmunterricht und bei Schullandwochen stets dabei war, ging ihre Lehrerin dennoch davon aus, dass sie an diesen Veranstaltungen als Türkin nicht teilnehmen dürfe. Während all den Jahren blieb Brigitte Köksal für Elif Yalcinkaya sehr wichtig. „So eine Person zu haben, war ein großer Luxus. Ich wusste, egal welchen Weg ich gehe, sie wird hinter mir stehen." Für Yalcinkaya war klar, dass sie nach der Schule im Sozialbereich tätig sein möchte. Mit 16 Jahren begann sie freiwillig bei der Caritas als Übersetzerin zu arbeiten, mit 18 Jahren war sie schon angestellt und bald war sie Betreuerin im Frauenwohnhaus der Caritas. „Es war immer mein Ziel, im Frauenbereich tätig zu sein, weil ich, relativ früh, die Ungleichheiten zwischen Mann und Frau erkannt habe. Ich wollte ein wertschätzendes Sprachrohr für Frauen und für Menschenrechte sein. Das ist nach wie vor mein Ziel!"
Die Gründung der Beratungsstelle „Divan"
Früh war sie bei ihrer Arbeit mit Zwangsheiraten und „Gewalt im Namen der Ehre" konfrontiert. Für sie ist der Begriff nach wie vor passend, „weil Männer Gewalt ausüben und die Ehre als Berechtigung oder Rechtfertigung benutzen. Aber nicht immer sind es Männer, die sich in ihrer Ehre verletzt fühlen und gewaltvolle Maßnahmen setzen, sondern auch weibliche Mitglieder. So etwa Mütter, die das Verhalten der Tochter nicht gutheißen und dann die Männer in der Familie beauftragen, die Familienehre zu schützen." Da es damals in der Steiermark keine Anlaufstelle für die vielen betroffenen Frauen gab, thematisierte Yalcinkaya im Jahr 2010 das Thema innerhalb der Caritas. Mit Hilfe einer privaten Stiftung konnte eine erste Pilotphase finanziert werden. „Da erkannten wir schnell, dass es eine Beratungsstelle braucht. Und es kam der Auftrag von der Stadt Graz, ein Konzept zu erstellen." Die Beratungsstelle entstand in enger Zusammenarbeit von Integrationsreferentin Brigitte Köksal, Elif Yalcinkaya und Christina Kraker-Kölbl, damals Teamleiterin im Frauenwohnhaus und später erste Leiterin der 2011 gegründeten Beratungsstelle Divan. Yalcinkaya: „Bei mir im Büro steht wirklich ein Divan, wo Frauen sich hinsetzen und in Ruhe und im Vertrauen alles erzählen können!" Neben ihr als muttersprachlicher Beraterin gab es bei Divan von Beginn an eine Juristin, „da Frauen zu ihren Rechten kommen müssen", wie Yalcinkaya betont. In der Community selbst gab es anfangs Stimmen, dass man ihr schon beibringen werde, wie sich eine Türkin zu verhalten habe. Dazu kamen Drohungen der türkisch-faschistischen Gruppe der „Grauen Wölfe". Inzwischen jedoch, freut sich Yalcinkaya, wird ihre Arbeit von vielen in der Community respektiert.
13 Jahre Arbeit bei Divan
Für Yalcinkaya ist Divan als spezialisierte Einrichtung, die neben muttersprachlicher Beratung auch juristische und psychologische Unterstützung anbietet, weiterhin äußerst wichtig. „Ich habe einen hohen Respekt vor jeder Frau, die den Weg zu uns schafft und uns ihre Lebensgeschichte anvertraut." Kaum eine Frau oder ein Mädchen habe vor, nach einer ersten Gewalteskalation die Familie oder den Ehemann zu verlassen. „Leider kennen wir die Gewaltspirale, welche die Frauen durchlaufen müssen, um zu einer Entscheidung zu kommen. Und egal wie eine Frau sich entscheidet, es gibt keine Verurteilung durch uns!"
Im Lend zu Hause
„Ich arbeite im Lend und ich wohne an der Grenze Eggenlend. Da fühle ich mich daheim.
Wenn ich mit der Straßenbahn die Unterführung beim Hauptbahnhof durchfahren habe, ab da beginnt für mich das Gefühl, das ich zu Hause bin!" Kritisch steht sie den Veränderungen in ihrer Wohnumgebung gegenüber: „Mir ist bewusst, dass gebaut werden muss, aber mittlerweile sind dort die ganzen Grünflächen verbaut worden und besonders in der Smart City werden Wucherpreise für kleine Wohnungen verlangt." Dass sie trotz ihrer Arbeit im Viertel wohnen bleibt, wo manche Angehörige ihrer Klientinnen wohnen, war für sie eine bewusste Entscheidung. Weiterhin ist es für sie auch normal, dass immer wieder Hilfesuchende bei ihrer Privatadresse anläuten oder jemand mit einem zu übersetzenden Brief vor der Wohnungstür steht. Yalcinkaya: „Diese zwei, drei Minuten, wo ich einen Brief übersetze und meiner Nachbarin dadurch ein Stein vom Herzen fällt, das sind die schönen Momente."



Schon im Vorfeld unseres Treffens fragte uns Margit Jöbstl, die 1948 im Bezirk Lend geborene Inhaberin des Hotels „Zu den 5 Lärchen" am Griesplatz, was sie denn zum Essen herrichten solle. Tatsächlich erweist uns die gelernte Köchin ihre Gastfreundschaft mit einer Jause samt einem Glas alkoholfreien Sekts. Zum Schluss folgen noch Kaffee und selbstgemachter Kuchen.
Vom Garagenmeister zum Hotelbesitzer
Während wir uns wie Hotelgäste fühlen, erzählt Jöbstl die jahrhundertealte Geschichte des ehemaligen Gasthofs hier in der einstigen Murvorstadt: „Er ist aus Bürgerspitalhäusern hervorgegangen, daher befindet sich die Bürgerspitalgasse an der Ostgrenze des Grundstücks." Was die wechselreiche Besitzer:innengeschichte betrifft, so habe vor dem Zweiten Weltkrieg eine Familie König den Betrieb geführt. Jöbstl: „Nach dem Krieg hat die verwitwete Frau König den Gasthof alleine weitergeführt."
Eine große Garage im Hof des Gasthofs diente den Bussen der Graz-Köflacher-Bahn (GKB) damals lange Zeit als Stellplatz. Vor rund zwei Jahrzehnten ließ Jöbstl das Gebäude abreißen und wandelte es zum bis heute von ihr betriebenen „GriesPARKplatz" um. Doch zurück in die Nachkriegszeit, in der ein gewisser Hermann Lang sich vom Garagenmeister zum Teilhaber hochgearbeitet hatte: „Nachdem Frau König gestorben war, ist der Gasthof in seinen Besitz übergegangen, und um 1956 - ich bin das Kind aus Mutters erster Ehe - ist meine Mama mit mir hierhergekommen und hat Herrn Lang geheiratet."
Unrealisierte Ausbaupläne
Gemeinsam modernisierte das Ehepaar den Standort ab dem Jahr 1958/59 Schritt für Schritt, um den geänderten Ansprüchen der Gäste gerecht zu werden. Jöbstl: „Das waren bis dahin einfache Zimmer mit einem ‚Kasperlofen‘, einem kleinen Eisenofen, der mit Kohle und Holz geheizt wurde." Nach den Umbauten wurde „das Haus Griesplatz 7 von Grund auf erbaut." Für die Umsetzung visionärer Pläne gab es auf Grund von behördlich vorgeschriebenen einheitlichen Dachobergrenzen keine Genehmigung. So seien noch die gegen Ende der 1950er-Jahre erstellten Umbaupläne vorhanden, die ein achtstöckiges Haus mit Dachrestaurant samt Blick auf den Schlossberg und über die Stadt vorsahen.
Margit Jöbstl selbst fing nach dem Abschluss ihrer vierjährigen Koch- und Kellner Lehre im Jahr 1966 im elterlichen Betrieb zu arbeiten an. Nachdem ihr Stiefvater und ihre Mutter in Pension gegangen waren, übernahm Jöbstl im Jahr 1976 selbst die Leitung des Unternehmens (zwischenzeitlich betrieb sie überdies eine Tracht- und Moden-Boutique am Griesplatz 7, mit dementsprechender Deko - und Farblehreausbildung).
Stolz schwelgt sie in Erinnerungen an die vielen internationalen, auch berühmten Gäste, welche die Zentrumsnähe sowie den Busparkplatz des Hotels für die damals sehr beliebten Busreisen zu schätzen wussten. Graz sei zu dieser Zeit für viele - ähnlich Poststationen in alten Zeiten - nur eine Übernachtungsstation am Weg zum eigentlichen Reiseziel gewesen. Aber so hätten viele Graz kennen und schätzen gelernt. Jöbstl: „Das Schöne war, dass Leute, die mit der Reisegruppe da waren, später als Einzelreisende mit ihrer Familie wiedergekommen sind."
Die Autobahn und der versiegende Besucher:innenverkehr
Die Modernisierung des Hotels fiel zusammen mit einer erhöhten (motorisierten) Mobilität und dem damit verbundenen Anwachsen des Reisetourismus. Abgesehen von Reisegruppen, Geschäfts- und Individualreisenden müsse, so Jöbstl, eine Gruppe ebenfalls erwähnt werden: „Da waren noch die Gastarbeiter auf der Durchreise, die unser Hotel dann um ein oder zwei Uhr in der Früh noch angefüllt haben. In so einem aufgepackten Auto waren sechs bis acht Leute drinnen, mit einem Fahrer, der gerade noch nicht eingeschlafen war." Als diese durch den Bau des Bahnhofsgürtels und später mit der Inbetriebnahme der Autobahn nicht mehr in Graz Rast gemacht hätten, sondern durchgefahren wären, hätte das Hotel seinen 24-Stunden-Rezeptionsdienst eingestellt.
„Fremdsprachen sind der billigste Kundendienst!"
Zu einem beträchtlichen Teil kamen die Reisenden aus Italien, aber nicht nur. Italienisch, Englisch und Französisch waren die Hauptsprachen von Gästen aus allen fünf Kontinenten.
So hätte sie für eine große Reisegruppe von iranischen Geschäftsleuten nicht nur die Zimmernummern auf Farsi gelernt. Noch heute erinnert sie sich gerne zurück, wie sich die Gäste darüber gefreut hätten: „Sie konnten kein Wort Deutsch. Als ich sie in ihrer Sprache begrüßt habe, ist ein Damm gebrochen. Das habe ich mit den Chinesen und Portugiesen auch gemacht. Für Russen habe ich sogar deren Wörter für die Speisen gelernt." Dazu recherchierte Jöbstl über religiöse Essensvorschriften oder gewisse kulturelle Eigenheiten, etwa von US-amerikanischen Reisenden. Denn als auch eine zweite Reisegruppe aus den USA „das Kotelett nicht gegessen hatte, dachte ich mir, warum? Ich kostete es, es passte. Da habe ich mir Filme angeschaut und daraus meine Lehren gezogen: die Amerikaner können nicht beißen! Darum habe ich meinen amerikanischen Gästen etwas Gedünstetes gekocht, die sich danach für das beste Essen auf der ganzen Reise bedankt haben."
Viel mehr als nur Gaststätten und Nachtlokale
Neben der Funktion als gut gehendes Hotel mit 100 Zimmern und 150 Betten dienten das „Hotel zu den 5 Lärchen" auch als Gaststätte. Das sei früher sogar das Hauptgeschäft für sie und weitere zahlreiche Gaststätten am Griesplatz gewesen, darunter das „Braunbuffet", der „Schwarze Adler" oder der „Schwarze Bär". Bedingt war dies durch die große Anzahl hier ankommender Busse, mit denen viele vom Land zur Arbeit in die Stadt kamen. Am Abend, bevor es wieder zurück aufs Land ging, seien viele Pendler:innen schnell auf ein Getränk und eine Plauderei in die Lokale am Platz eingekehrt. Jöbstl erinnert sich: „Wir hatten auf wenigen Hundert Metern 80 verschiedene Branchen, vom Arzt bis zur Zeitungsredaktion und vom Autosalon bis zum Schlosser und Schmied!" Immer schon, betont Jöbstl, standen der Bezirk Gries und seine Bewohner:innen Fremdem offen gegenüber. Jöbstl: „So auch heute, wo viele zugezogene ausländische Mitbürger hier Geschäfte betreiben, arbeiten und Steuern zahlen."
Weniger positiv blieben ihr andere Erlebnisse mit der Landbevölkerung im Viertel in Erinnerung: In alten Zeiten, „wenn die Bauern mit ihren Fuhren nach Graz gekommen waren und das verkauft hatten, dann spielten sie den großen Mann, indem sie das Geld verspielt oder sonst irgendwie mit Vergnügen losgeworden sind. Das war für uns junge Frauen, die da aufgewachsen sind, nicht angenehm!" Die „5 Lärchen waren jedoch immer der Leuchtturm" am Platz und Jöbstl hat sich von diesem Milieu stets vehement distanziert.
Der Lärchensaal
Errichtet im Jahr 1962, erlangte der großräumige Lärchensaal in den folgenden Jahrzehnten als eines der wichtigsten Veranstaltungszentren der Stadt große Bekanntheit. Hier fanden alle Arten von Veranstaltungen statt, von Betriebsversammlungen über Jahreshauptversammlungen und Weihnachtsfeiern und Bälle von Vereinen, bis hin zu politischen Wahlveranstaltungen aller damaligen Parteien. Daneben diente der Saal den Reisgruppen als Speiseraum - aber nicht nur! Nachdem eine italienische Pfarrgruppe samt Priester hier eine Messe gefeiert hatte, hätte sich das derart herumgesprochen, „dass wir sechs Pfarrausflüge hatten in der Saison, die jedes Mal im Lärchensaal die Messe lasen".
Vom Hotelgast bis zum Dauergast
Schon vor Jahrzehnten hatte Jöbstl ihren Beherbungsbetrieb den geänderten Rahmenbedingungen angepasst, indem sie Langzeitvermietungen ermöglicht. Dieses Angebot habe sie gestartet, als Massageinstitute für die Teilnehmenden an deren sechswöchigen Kursen in Graz erschwingliche Unterkünfte gesucht hätten. Als nächstes habe Jöbstl Zimmer mit eigenen Gästeküchen eingerichtet, die von vielen in- und ausländischen Gästen genutzt worden seien, die für einige Monate in Graz Arbeitsaufträge zu erledigt hatten. Nachdem Jöbstl in einer letzten Ausbaustufe ganze Apartments mit Küche errichten ließ, wird das Haus inzwischen unterschiedlich lange von einer Vielzahl von Menschen aus vielen Ländern bewohnt, die in Graz ihrer Arbeit nachgehen.
„Ich brauche Hirnnahrung"
Was ihr Leben abseits der Arbeit betraf, so musste die Unternehmerin Jöbstl viele Jahre lang auf einen eigenen Urlaub verzichten. Zum Ausgleich hatte sie nach der Arbeit spätabends viel gehandarbeitet (bis heute dekorieren ihre Werke die Wände) und viel gelesen. Nebenbei bildete sie sich in den unterschiedlichsten Bereichen weiter. So hängt in ihrem Büro jener ganzseitige Zeitungsartikel an der Wand, der in den 1990er-Jahren über sie als erste Frau in Österreich mit einem Hubschrauber-Pilotinnenschein berichtete. Jöbstl: „1973 machte ich den Flächenschein zur Privatpilotin. Irgendwann ist mir das zu langweilig geworden und ich habe wieder etwas zum Lernen gebraucht!" Zu ihren weiteren Aus- und Fortbildungen zählen Sprachkurse, Ausbildungen zur Hygienemanagerin und Sicherheitsfachkraft, die Prüfung für den Jagdschein sowie mit 50 Jahren den Gewerbeschein für die Tätigkeit als Astrologin. Da es im Laufe der Jahrzehnte immer wieder Um- und Ausbauarbeiten gab, hat Jöbstl sich auch ein umfangreiches Wissen diesbezüglich angeeignet. Ebenso war sie über Jahre sehr erfolgreich bei Schießbewerben und erst in den letzten Jahren machte sie Kurse zur Lebensraumberaterin und für Aufsichtsrät:innen, „weil ich wissen wollte, was ein Aufsichtsrat so macht".
Voll von Eindrücken verabschieden wir uns von Frau Jöbstl, einer immer noch äußerst aktiven Unternehmerin mit einem beneidenswerten bis heute ungebrochenen Tatendrang.



Die Grazer Oper ist seit Jahrzehnten Arbeitsplatz des im Iran ausgebildeten Musikers Hooman Khalatbari. 1969 wurde er in eine gebildete, gesellschaftlich hochstehende Teheraner Familie hineingeboren - von da an begleitete ihn die Musik. Schon seine Großmütter waren von Privatlehrer:innen unterrichtet worden und konnten so etwa das traditionelle Musikinstrument Tar spielen. Das war, so Khalatbari, damals sehr besonders, da Frauen offiziell kein Instrument spielen durften und sich nur wenige überhaupt Musikinstrumente leisten konnten.
Khalatbari war erst etwa sechs Jahre alt, als ihn seine kunstinteressierte Mutter zum ersten Mal in das Teheraner Konzerthaus Talar-e-Rudaki mitnahm. „Eigentlich war es verboten, ein Kind mitzunehmen. Aber die Kontrolleure im Haus, die haben mich bald gekannt und gewusst, dieser Junge ist so still und konzentriert. So durfte ich mit meiner Mama alles ansehen: Opern, Ballett und Konzerte." Damals gastierten im berühmten Konzerthaus viele internationale Künstler:innen, wie etwa Herbert von Karajan, Elisabeth Schwarzkopf oder Yehudi Menuhin.
Schon als Kind wollte er Dirigent werden
Mit sieben Jahren bekam Hooman Khalatbari sein heißersehntes erstes Klavier. „Ich hatte großes Glück, dass meine erste Lehrerin, Nayere Rezaie Oskoui, eine Pianistin war, die im Hamburger Konservatorium studiert hatte und ihre Arbeit sehr ernst nahm." Neben seinem Wunsch, ein Musikinstrument zu erlernen, war ihm bereits als Kind klar, dass er so wie jene werden wollte, die im Konzertsaal vorne stehen und die Hände bewegen. „Ich kann mich gut daran erinnern, als ich zum ersten Mal einen Dirigenten sah. Wir saßen in einem Schwanensee-Ballett, in einer der vorderen Reihen. Der Vorhang ging auf und ich war verzaubert." Da seine Klavier-Lehrerin meinte, dass man als Dirigent:in gut Klavier spielen müsse, war dies seine Motivation für das tägliche Üben. Inzwischen, so Khalatbari, habe sich das stark verändert. „Es gibt junge Dirigenten, da spielt einer Klarinette, ein anderer Geige und viele können keinen Ton am Klavier spielen." Problematisch sei das, wenn Dirigent:innen für Opern am Klavier mit den Sänger:innen allein üben müssten.
Auch in seiner weiteren Ausbildung hatte Khalatbari Glück mit seinen Lehrer:innen. Nach dem Besuch des Konservatoriums war sein letzter Lehrer im Iran Thomas Christian David. Dieser österreichische Komponist, der perfekt Farsi sprach, hatte in der Schah-Zeit die Musikabteilung an der Teheraner Universität aufgebaut . Anfang der 1990er-Jahre kam er nach vielen Jahren wieder nach Teheran. „Ich wurde sein Privatassistent und er hat mir das Dirigieren beigebracht." Daneben studierte Khalatbari persische Musik an der Teheraner Musikuniversität und war als Chor-Assistent, Pianist und Dirigent vielbeschäftigt. Eines Tages beschloss David, dass Khalatbari bei einer großen Veranstaltung in der österreichischen Botschaft Mozarts Kleine Nachtmusik dirigieren sollte. Nach dem gelungenen Auftritt meinte David, dass Khalatbari nun bereit sei, um für das Weiterstudium nach Österreich zu kommen.
1996 als Student an die Grazer Musikhochschule
So kam Khalatbari im Jahr 1996 nach Graz, um an der damaligen Musikhochschule die Aufnahmeprüfung zu machen. „Damals gab es noch keine E-Mail. Den Prüfungstermin bekam man mit der Post und dann musste man zur Botschaft und bekam ein Visum." Graz wählte er eher zufällig aus, da ein guter Freund von ihm hier ein Jahr zuvor mit dem Studium angefangen hatte. Da er bei der Aufnahmeprüfung durchgefallen war, wurde er zuerst nur als außerordentlicher Student aufgenommen. Zwei Monate später bekam er nochmals eine Chance und danach konnte er sein Studium beginnen.
Durch die Konzentration auf das Studium vernachlässigte er jedoch das Deutschlernen im Vorstudienlehrgang. Nachdem er zweimal durchgefallen war, war die dritte Deutschprüfung seine letzte Chance, das Studium in Österreich weiterzuführen. Der Prüfungstermin war jedoch zeitgleich mit der Generalprobe seines ersten universitären Chorkonzerts im Minoritensaal angesetzt. „Da telefonierte die Assistentin meines Professors Rupert Huber mit den Lehrern des Deutschkurses und hat sie zum Konzert am Abend eingeladen." Danach gratulierten sie ihm und meinten: „Morgen früh um 10.00 Uhr sehen wir uns zur Prüfung!" Dort sollte er ihnen dann erzählen, wie das Konzert gestern war. „Mit diesem Dialog hatte ich die Prüfung bestanden." Seine beiden Studien (Bachelor für das Fach Chordirigent und Master für das Fach Orchester) schloss er schließlich im Jahr 2005 ab.
... und wieder jeden Abend in der Oper
Es war ein sehr großer Unterschied zwischen der Großstadt Teheran und dem „kleinen, ruhigen, grünen, schönen Graz voller Kultur. Das hat mir sehr gut gepasst. Da man damals im Opernhaus mit dem Studentenausweis einen gratis Stehplatz bekam, war ich jeden Abend hier. So wie als Kind im Teheraner Opernhaus haben mich hier auch alle bald gekannt."
Noch während seines Studiums begann er um 1998 über Vermittlung eines iranischen Studienkollegen, an der Grazer Oper als Beleuchter zu arbeiten. „Ulrich Lenz ist jetzt mein sechster Intendant, den ich hier am Haus erlebe." Später kam zur Beleuchtung noch der Kinderchor dazu. Während all der Jahre wurde er nur über sogenannte Stückverträge beschäftigt, die von der Probe bis zum Ende der Aufführungen eines Stückes dauern. „Jedes Jahr habe ich vom Intendanten bis zum Betriebsdirektor alle gefragt, wann ich endlich eine Festanstellung bekomme, und jedes Mal wurde ich auf die kommende Saison vertröstet. Ich war sogar beim Kulturstadtrat und habe ihn um Hilfe gebeten. Endlich im Jahr 2022 habe ich nach rund zwei Jahrzehnten eine Teilzeitanstellung als Beleuchter bekommen."
Erfolgreich außerhalb seiner Heimatstadt Graz
In etwa zur selben Zeit, als seine Arbeit an der Oper begann, also Ende der 1990er-Jahre, dirigierte Khalatbari zum ersten Mal Konzerte im niederösterreichischen Kirchstetten. „Das war Così fan tutte mit der später berühmten Anette Dasch", erinnert sich Khalatbari. Seit 2001 ist er als musikalischer Direktor und Dirigent fixer Bestandteil des Klassikfestivals Schloss Kirchstetten im Weinviertel, das jedes Jahr eine Reihe bekannter Musiker:innen versammelt.
In seiner langen Karriere, betont Khalatbari, habe er eine Vielzahl von Konzerten mit verschiedenen Orchestern dirigiert. Stolz führt er weiters aus: „Als Dirigent habe ich alleine über 25 Opernpremieren geleitet, bis hin zur österreichischen Uraufführung von Gaetano Donizettis Oper ‚I pazzi per progetto‘!" Daneben ist er immer wieder im Ausland tätig, etwa in Kanada, Großbritannien, Schweden und Tschechien. „Wenn ich international auftrete, dann mache ich immer Werbung für Graz", so Khalatbari.
Ein Star mit rund 900.000 Followern
Einem Zufall ist es zu verdanken, dass er seit inzwischen über einem Jahrzehnt auch bei einem (vorrangig) iranischen Publikum weltweit bekannt und hoch angesehen ist. „Ich war zufällig zu Hause, als mein Festnetz läutete." Am anderen Ende der Leitung war ein Mitarbeiter des britischen Fernsehsenders Manoto, der anfragte, ob er bei einer TV-Talente-Show mitmachen würde, die nach dem iranischen Superstar und der Hauptjurorin Googoosh unter dem Titel „Googoosh Music Academy" laufen sollte. Khalatbaris Glück war, dass einem zuvor angefragten Musiker die notwendigen Reisedokumente fehlten.
Durch diese Musikshow, die weltweit von einem Millionenpublikum gesehen wurde und in der Hooman Khalatbari von 2011 bis 2013 als akademisch ausgebildeter Gesangsmentor mit iranischen Musiktalenten arbeitete, wurde er über Nacht weltberühmt. Und dieser Ruhm hat bis heute angehalten. Hatte er damals etwas über eine Million Follower, so folgen ihm auf Facebook immer noch über 933.000 und auf Instagram 891.000 Personen. Zahlen, von welchen der überwiegende Teil der steirischen Musiker:innen und Musikinstitutionen nur träumen kann - so folgen etwa dem Grazer Opernhaus auf Instagram nicht ganz 12.000 Personen. Viele Iraner:innen, so Khalatbari, würden weltweit seinen Livevideos auf Social Media folgen, wo er ihre musikalischen Fragen beantwortet. Khalatbari: „Ich bin kein Komponist, der mit dem Bleistift und Papier herumsitzt. Ich muss schreien, schwitzen, muss Kontakt haben mit den Leuten."
Immer in der Grazer Innenstadt gelebt
„Ich bin seit 28 Jahren hier, das ist mehr als die Hälfte meines Lebens. Klar ist Graz meine Heimatstadt! Wenn ich länger weg bin, dann vermisse ich Graz und die Steiermark immer." Khalatbari, der seit vielen Jahren in der Nähe des Jakominiplatzes wohnt: „Ich liebe die Innenstadt, das ist mein Lieblingsort." Hier sei es lebendig, es gäbe viele Aktivitäten und viele Bekannte, welchen man auf der Straße begegne und mit denen man ins Gespräch komme. „Dieses Kommunizieren genieße ich einfach." Ein wichtiger Treffpunkt für ihn ist der Kaiser-Josef-Markt, wo er beinahe jeden Samstag bei einem Kaffee anzutreffen ist.
Und wie geht es ihm damit, dass er - als weltweit bekannter Star - hier in Graz immer noch so wenig bekannt ist? Khalatbari: „Natürlich ist das kein schönes Gefühl. Nach über 20 Jahren warte ich immer noch, dass hier in diesem Opernhaus und in dieser Stadt irgendwann die Tür auch für mich offen ist."



Vor rund 25 Jahren wurde in Österreich das Bestattungswesen liberalisiert, wodurch sich in Graz neben der „Bestattung Graz" mehrere private Bestattungsunternehmen etablierten. Laut Christoph Hufnagl, der seit neun Jahren als Bestatter tätig ist (davon seit vier Jahren bei seinem aktuellen Arbeitgeber in der Alten Poststraße) sei der Gebietsschutz von einst „in den Köpfen mancher noch drinnen, vor allem am Land." Da in Graz ein gewisser Wettbewerb herrsche, versuche man schon, sich von anderen Bestattungsunternehmen abzusetzen, etwa in Form eines Podcast. In bisher 20 Folgen von „Ein Abschied. Ein Licht. Ein Podcast der PAX-Bestattung" versuchen Hufnagl und sein Kollege, das Thema Tod zu enttabuisieren und „ein bisschen Schmäh reinzubringen, trotz aller Ernsthaftigkeit".
Bevor wir uns weiter der Arbeit von Hufnagl widmen, den wir an seinem Arbeitsplatz treffen, der direkt an den Zentralfriedhof angrenzt, gilt es, mehr über die Person hinter dem Bestatter zu erfahren.
Nur ganz knapp überlebt
Ende der 1980er-Jahre kam der gebürtige Oberösterreicher für das Jusstudium nach Graz. „Als Anwalt sagt man etwas und kann damit die Leute überzeugen. Das hat mir gefallen." Daraus wurde aber nichts, denn nur ganz knapp überlebte er mit 22 Jahren einen Motorradunfall, bei dem er ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt. Noch Jahre danach hatte er mit Konzentrationsschwierigkeiten zu kämpfen und konnte sich Gelesenes schlecht merken. So ging er zurück nach Oberösterreich, wo er zufällig einen Hilfsarbeiterjob in einer Schlosserei fand und nebenbei eine Lehre als Schlossergeselle abschloss.
Schlosser und Student
Als es ihm gesundheitlich wieder besser ging, kam er - inzwischen schon über 30 - zurück nach Graz und widmete sich mit seinem Linguistikstudium nun der Sprache, die ihn seit der Kindheit faszinierte. „Ich suchte mir einen Job in einer Schlosserei in Andritz. Später kam ich zur Automobilindustrie in Thondorf, weil ich wusste, da kann ich Schicht arbeiten. Das würde mir erlauben, wieder auf die Uni zu gehen." Gesagt - getan. Hufnagl: „Ich galt am Institut für Sprachwissenschaft als Exot, was den Professoren gefiel. Sie hatten einen Schlosser, der Autos zusammenschweißt und bei ihnen Linguistik macht." Im selben Alter und motiviert wie er war damals sein Studienkollege, Fußballspieler Gilbert Prilasnig.
Seine soziolinguistische Diplomarbeit widmete Hufnagl den Motorrad-Rockern der „Hells Angels", mit welchen er seine Affinität zu „Harley-Davidson"-Motorrädern teilt. Nach seinem Unfall wieder auf ein Motorrad zu steigen, sei für ihn übrigens kein Problem gewesen, „weil mir jede Erinnerung daran völlig fehlt!" Auch darüber hinaus gäbe es Erinnerungslücken. So zeige eine Fotografie, wie er als Jugendlicher in die Donau springt: „Ich kann mich an das T-Shirt erinnern, das ich angehabt habe. Und sehe, dass ich hineinspringe. Aber ich weiß es nicht mehr!"
„Tote Leute - sicher nicht!"
Obwohl er sich anfangs einiges davon erwartet hatte, änderte der Abschluss seines zehnjährigen Studiums nicht viel. Hufnagl: „Am nächsten Tag ging ich wieder arbeiten. Mich und meine Familie hat es sehr gefreut und das war´s." Bald darauf hörte er in der Automobilbranche auf und jobbte einige Zeit in einem Spielcasino. Nach unzähligen erfolglosen Bewerbungen stolperte er über das Zeitungsinserat eines Bestattungsunternehmens. Hufnagl: „Ich fand es witzig, dass eine Bestattung eine Stellenausschreibung macht, aber dachte mir: Tote Leute - sicher nicht!" Ohne es richtig ernst zu nehmen, habe er sich beworben und wurde gleich vom Unternehmen zum Schnuppern eingeladen. Hufnagl: „Am ersten Tag merkte ich, man muss sich vor den Toten nicht fürchten - anders als vor vielen Lebenden." Und im Gespräch mit den Angehörigen eines Verstorbenen fühlte er, dass er etwas tat, „was ihnen hilft. Das war ein enorm lohnendes Gefühl. So etwas hatte ich in keinem Beruf zuvor erlebt!"
Oft der erste Seelsorger vor Ort
Bestatter zu sein, sei ein sehr verantwortungsvoller Beruf. Das gilt für jeden Schritt vom Moment an, in dem man den Anruf entgegennimmt, dass gerade jemand verstorben ist. Es ist ein/e Beschauarzt/-ärztin zu organisieren, um den Leichnam für die Bestattung freizugeben. Danach fährt man zu dem Ort, an dem der Verstorbene abzuholen ist und wo Hinterbliebene trauern.
Ein Vertreter der altkatholischen Kirche habe dazu einmal etwas für Hufnagl sehr Wichtiges gesagt: „‚Der Bestatter ist der erste Seelsorger vor Ort.‘ Er hat recht. Man muss ein Empathievermögen haben und sich fragen: ,Der Opa liegt tot am Boden, weil er einen Herzinfarkt gehabt hat. Wie geht es diesen Menschen damit, die dort im Wohnzimmer sitzen?‘"
Saßen wir bis jetzt gemütlich beim Kaffee im Eingangsbereich, so zeigt uns Hufnagl nun seine Arbeitsbereiche und beantwortet unsere vielen Fragen, die sich einem hier aufdrängen.
Die Dinge beim Namen nennen
Da die Menschen immer schwerer werden und es oft vorkomme, dass man den Leichnam über längere Wege tragen müsse, benötige man als Bestatters eine gute körperliche Konstitution. Deshalb, so Hufnagl, gäbe es im Unternehmen einen eigenen Fitnessraum, der von den Mitarbeiter:innen auch genutzt werde. Hufnagl: „Das ist auch der Hauptgrund, warum im operativen Bereich weniger Bestatterinnen tätig sind, weil du nie weißt, was dich erwartet. Etwa, wenn du eine Person mit 170 Kilo aus dem Keller über eine enge Stiege bergen musst." Wollen Angehörige beim Abtransport dabei sein, mache er diese darauf aufmerksam, dass bei einem Leichnam noch ein Restvolumen Luft in den Lungen sei: „Wenn ich den Körper aufhebe, ist es wie ein Blasebalg. Luft kommt raus und es kann sein, dass die Stimmbänder zu vibrieren anfangen. Oder es kann sein, dass sich der Schließmuskel öffnet." Seiner Ansicht nach dürfe man sich nicht scheuen, die Dinge beim Namen zu nennen. In dieser Situation sei den Hinterbliebenen am besten damit geholfen, wenn man ihnen Ablauf und Bedeutung der Handlungen erkläre.
Mit der Jogginghose ins Grab?
In der sogenannten Prosektur werden die Verstorbenen gewaschen, angezogen und mit dem Sarg bis zur Verabschiedungsfeier zumeist für einige Tage eingekühlt. Das hänge jedoch von der Religion ab. Hufnagl: „In manchen Religionen, etwa im Islam, gibt es rituelle Waschungen." Dabei werden männliche Verstorbene von Männern und weibliche von Frauen gewaschen. „Wir bieten den Raum und das Equipment an und ziehen uns dann zurück."
Im hell gestalteten Verabschiedungsraum erläutert Hufnagl, dass Trauerfeiern sich je nach Generation unterscheiden würden. Obwohl Aufbahrungen mit offenem Sarg mittlerweile seltener vorkämen, gäbe es gerade bei vielen älteren Hinterbliebenen traditionelle Vorstellungen, wie etwa der verstorbene Ehemann angezogen zu sein habe. Auch wenn dieser, wie Hufnagl eindrucksvoll schildert, seine Jogginghose geliebt hätte, würde die Witwe sich schließlich doch für den Hochzeitsanzug entscheiden, da man noch mehr im Kopf habe, was Verwandte oder Nachbar:innen über eine/n sagen. Hufnagl: „Die jüngere Generation ist ein bisschen offener und progressiver, wenn es um die Gestaltung einer Trauerfeier geht, beispielsweise die Auswahl der Musik" oder auch die Raumgestaltung. Dabei könne, wie es bei einem langjährigen ehemaligen Mitarbeiter des Puchwerks geschehen ist, bei der Trauerfeier auch schon mal ein Motorrad neben dem Sarg stehen.
Schon viel Unvorstellbares gesehen
Bei der Arbeit habe er von Mord- bis zu Selbstmordopfern oder Leichen, die schon Wochen in einer Wohnung gelegen sind, vieles Unvorstellbares gesehen. Hufnagl: „Ich kann trotzdem nach Hause gehen und gut schlafen." Und wenn ein Kind gestorben ist? „Ein Kind ist mein persönlicher Supergau. Wenn dich das nicht berührt, dass da ein totes Kind in einem Sarg liegt, der einen halben Meter groß ist, dann bist du kein Mensch!" Kinder seien immer ein großes Thema, einerseits als Verstorbene, aber auch als Angehörige von Verstorbenen. Für derartige Herausforderungen gäbe es jedenfalls die Möglichkeit zum Gespräch mit einer Psychologin. Im Unternehmen gibt es zudem „vierteljährlich eine Gruppensupervision, die wir verpflichtend wahrnehmen".
Wie ist sein eigenes Verhältnis zum Tod? Hat sich das durch die Arbeit verändert? „Ich habe Angst vor dem Tod wie alle anderen. Nur weil ich Bestatter bin, habe ich keine Idee, was nachher ist. Dass allerdings etwas nachher ist, davon bin ich mittlerweile überzeugt."
Zum Schluss unseres langen und immer noch zu kurzen Gesprächs, wollen wir noch erfahren, wie wohl sich Hufnagl in seinem Bezirk fühlt: „Ich lebe sehr gerne in Liebenau und finde es vom Pragmatischen her perfekt. Ich bin gleich auf der Autobahn und im Einkaufszentrum." In die Stadt selbst sei es ebenfalls nicht weit, wohnt er doch in der Nähe des Murradwegs. Seine Wohnumgebung sei „eine gute Symbiose aus der Ruhe, die ich haben möchte, und trotzdem noch zentraler Lage."



Wir besuchen die bildende Künstlerin Severin Hirsch in ihrem Künstlerinnenatelier in der Puchstraße. Ihre künstlerischen Arbeiten sind auf den Wänden zu bewundern, Gemälde und Fotorahmen stapeln sich am Boden neben ihrem Arbeitstisch. Seit rund fünf Jahren dient ihr das Atelier auch als privater Rückzugsort und wichtige räumliche Ergänzung zu ihrer Wohnung.
Doch wie kam sie überhaupt, die als Severin Sever in Slowenien aufgewachsen ist, nach Graz? Hirsch: „Wie die Mehrheit der Frauen, die migrieren, wenn sie keinen Krieg im Hintergrund haben, bin ich wegen der Liebe migriert." Für ihren damaligen österreichischen Partner ließ sie ihr altes Leben als freischaffende Fotografin in Ljubljana zurück. Sie zog im Sommer 2003 mit 31 Jahren in die Steiermark, da das Paar für sich hier aufgrund des guten Jobs des Ehemanns bessere Chancen sah.
Fuß fassen in einer neuen Stadt
In Graz machte sich Hirsch daran, ihre Karriere als freischaffende Fotografin fortzusetzen, was sich in den ersten Jahren als sehr schwierig erwies. Auf eine erste Fotoausstellung in der Steiermark, in der sie sehr einfühlsame Portraits von Eisenerzer Bewohner:innen präsentiert hatte, folgten weitere Ausstellungen. Mit Hilfe öffentlicher Fördergelder und einem Atelierzuschuss der Stadt Graz gelang es ihr schließlich, auch in Graz als Fotokünstlerin erfolgreich zu sein. Nebenbei absolvierte sie, die immer schon gerne malte, die Meisterklasse für Malerei. Den 2016 in festlichem Rahmen an sie verliehenen Kunstförderungspreis der Stadt Graz sah sie insofern als wichtige Bestätigung dieser langjährigen Anstrengungen: „Ich habe mich gefreut, weil jede und jeder Künstler:in braucht einmal eine Bestätigung, dass man in die richtige Richtung denkt und gute Sachen macht."
In den Mühlen der Bürokratie
Dabei wollte sie einige Jahre zuvor, nachdem es zur Scheidung kam, bereits aufgeben und nach Slowenien zurückkehren. Dass sie blieb, verdankt sie dem Zureden einer guten Freundin, der im Jänner 2015 verstorbenen Dagmar Grage. Diese betonte, wie viel Hirsch hier bereits erreicht hätte und dass sie auch in Ljubljana wieder neu anfangen müsse. Dennoch spürte Severin Hirsch damals zum ersten Mal so richtig, was es heißt, fremd zu sein, denn „plötzlich war es rechtlich nicht mehr so klar, ob ich dableiben kann oder nicht." Als sie mit ihrem Problem zum Verein Zebra kam, war man dort empört, dass ihr so etwas als EU-Bürgerin in Österreich passieren könne. Dann habe die Mitarbeiterin von Zebra „zwei Telefonate gemacht, einen Zettel geschrieben und gesagt: ‚Sie gehen zu dieser Person, die soll Ihnen das und das geben und unterschreiben und dann gehen Sie damit zu dieser zweiten Person und sagen ihr ganz liebe Grüße von mir!‘ So habe ich es gemacht und dann war es wie - puff! - und meine rechtlichen Probleme waren weg!" 15 Jahre später erinnert sich Hirsch immer noch, wie sie damals jedes Mal ängstlich war, „wenn ich offizielle Briefe bekommen habe, mit diesen unverständlichen Forderungen an mich."
„Ja, dann gemma putzen!"
Nach der Klärung ihres Aufenthalts wurde sie beim Arbeitsmarktservice als Arbeitssuchende vorstellig. Es folgte die nächste Verunsicherung, denn „der nette Herr dort meinte: ‚Ja, Frau Hirsch, dann gemma putzen!‘ Und ich daraufhin: ,Ja, mein Herr, dann finden Sie mir diesen wunderbaren Putzjob!‘" Dazu kam, dass ihre in Slowenien absolvierte Ausbildung im Kolleg für Fotografie und Kunst nicht anerkannt wurde, da es damals in Österreich nichts Vergleichbares gab. „Ich habe mich dann weitergebildet, weil ich keine Zeit verlieren wollte, indem ich von Amt zu Amt renne und zu erklären versuche, dass meine Ausbildung doch etwas wert ist." Obwohl sie in der Folge Ausbildungen machte, die zum Teil unter dem Niveau ihres in Slowenien absolvierten Abschlusses lagen, hätten sich, so eine frustrierte Hirsch, die Jobangebote des AMS nur wenig verändert. Da sie bis heute als Künstlerin von der Kunst alleine leider nicht leben könne und um endlich ihren Prekariats-Jobs entfliehen zu können (Hirsch: „Ich bin jetzt über 50 und habe gesehen, dass ich mir diese Unsicherheit nicht mehr leisten kann!"), macht sie in seit einigen Jahren Weiterbildungen zur Mal- und Gestaltungstherapeutin, Lebens- und Sozialberaterin und Kulturmanagerin.
Wie ein Riese auf zwei tektonischen Platten
Und wie steht sie nach über 20 Jahren in Graz zur Stadt? Hirsch: „Ich lebe hier und habe mein ganzes Leben hier aufgebaut. Ich habe einen Mann, eine Wohnung und ein teures Atelier in der Stadtmitte. Ich habe viele Bekannte, Freunde und Freundinnen. Also: ich bin da." Es sei daher klar, dass Graz und seine Menschen sie in ihrer künstlerischen Arbeit beeinflussen. So widmete sie sich in einem erfolgreichen Fotoprojekt Menschen, die in Österreich und Slowenien den selben Familiennamen tragen. „Zur Ausstellung, die im ORF-Zentrum gezeigt wurde, kamen fast alle porträtierten Personen und tatsächlich entdeckten wir bei zwei Namenspaaren eine historische Verbindung!"
Die Frage der Beheimatung und der Auswirkungen von Migration sind Themen, die sie immer wieder beschäftigen: „Ich denke, wir Menschen mit Migrationshintergrund, wir sind wie ein Riese auf zwei tektonischen Platten. Wir balancieren und wenn es mit der Balance nicht mehr geht, dann suchen wir uns andere tektonische Platten. Wir halten uns über Wasser. Für mich ist Heimat nicht mehr mit einem Staat oder Land verbunden." Dieses Gefühl ist sehr stark durch ihre Biografie und den Zerfall des Staates Jugoslawien geprägt: „Meine Heimat Jugoslawien wurde durch einen blutigen Brüder-Schwestern-Krieg vernichtet. Aber ich bleibe ein Kind Jugoslawiens. Ein Großvater war Serbe, der andere Kroate. Beide Großmütter waren Sloweninnen, wobei die eine von der italienischen und die andere von der steirischen Seite kam!"
Nur beschränkte Möglichkeiten politischer Partizipation
Problematisch sei für sie, die ihre slowenische Staatsbürgerschaft behalten habe, der Umstand, dass sie sich in Österreich nur sehr eingeschränkt politisch aktiv an der Gesellschaft beteilige könne. Bei gewissen Wahlen ist sie hier ausgeschlossen. An Wahlen in Slowenien nehme sie teil, „weil ich mir bewusst bin, dass meine Ahnen dies nicht tun konnten. Es ist mir extrem wichtig, dass ich politisch meine Stimme erhebe. Aber für mich ist es komplett absurd, dass ich einen Monat vor einer Wahl in Slowenien beginne, mit meinen slowenischen Freund:innen zu telefonieren, um stundenlang mit ihnen die Politik dort zu analysieren. Und hier, wo ich seit Jahrzehnten lebe und meine Steuern bezahle, kann ich überhaupt nichts tun!"
Erst vor Kurzem war ihr bei der Vorbereitung zu einer Ausstellung die wachsende Distanz zu ihrem Herkunftsland aufgefallen, da sie in den letzten Jahren nur zwei Gedichte auf Slowenisch und alle anderen auf Deutsch oder Englisch geschrieben hatte. Hirsch: „Ich sehe, dass die slowenische Sprache mir entschwindet. Das ist traurig. Aber das ist zu erwarten, wenn du etwas nicht täglich in Gebrauch hast." Zum anderen würden jedoch, sobald sie zu sprechen beginne, alle wissen, dass sie Ausländerin sei, da sie die deutsche Sprache nie so richtig gelernt habe. „Ich habe ‚Straßenösterreichisch‘ oder Steirisch - oder wie immer man das nennen will - gelernt. Und natürlich habe ich viel gelesen und meinen deutschen Wortschatz dadurch enorm verbessert. Trotzdem ist ziemlich schnell klar, dass ich nicht von hier bin, wenn ich meinen Mund aufmache."
„Ich brauche kein Grün!"
Zuletzt möchten wir von Severin Hirsch noch wissen, inwiefern sie, die in St. Peter wohnt, sich ihrem Bezirk verbunden fühle. Auch diesmal fällt ihre Antwort überraschend aus, denn tatsächlich sei der Umstand, dass sie seit Jahren dort wohne, vor allem dem Umstand der Leistbarkeit geschuldet. Früher hatte sie immer gerne in der Altstadt gewohnt - meistens in Wohnungen im Bezirk Lend. Rückblickend betrachtet, bereute sie ihren Umzug in diesen Grazer Randbezirk schon bald: „Ich habe schon in der zweiten Woche gewusst, dass ich wieder weg muss!" Mittlerweile sind bereits einige Jahre vergangen, seit sie mit ihrem Lebenspartner dorthin gezogen ist. „Momentan habe ich leider kein Geld, um in eine teurere Wohnung in der Stadt umzuziehen." Mehr Grün und Ruhe im Wohnumfeld sind für Hirsch, welche die Urbanität liebt, ebenfalls keine Vorteile: „Ich brauche es nicht grün. Wenn ich es grün haben möchte, dann schaue ich mir grüne Farben an. Und was andere ruhig nennen, ist für mich tot." Aushaltbar machen es für sie wiederum einige der Menschen, die in ihrer Nachbarschaft dort leben. Hirsch: „Neben den Nachbar:innen, die ich schon von früher kannte, gibt es eine Nachbarin, mit der ich ab und zu ein Gläschen Wein trinke und ein junges Pärchen, mit dem ich mich gut verstehe. Gegenseitig unterstützen wir uns."



Im Bezirk Waltendorf, abseits der belebten Ragnitzstraße, lebt Eva Reithofer-Haidacher mit ihrem Mann Robert. Eigentlich könnte sie, im Juli 1963 geboren, schon in Pension sein. Bis zum Jahr 2026 möchte Sie aber noch ihre Arbeit bei der Grazer Organisation „LebensGroß" (bis 2023: „Lebenshilfe") weiterführen, die sich für Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen sowie für solche mit Hürden am Arbeitsmarkt einsetzt. Ein weiteres Arbeitsgebiet der Organisation ist die Arbeit für Flüchtlinge, in dem Reithofer-Haidacher für ukrainische Vertriebene tätig ist. Da sie viele Arbeiten von zu Hause aus erledigt, besuchen wir sie an ihrem Homeoffice-Arbeitsplatz im Einfamilienhaus der Familie Reithofer-Haidacher.
Ein Haus in der Ragnitz für die Großfamilie
Eva Reithofer-Haidacher war noch klein, als die Familie in das neu errichtete Haus in diesem damals noch kaum verbauten Teil der Ragnitz zog. Nach der Stadtwohnung war für sie und ihre sechs Geschwister das Haus mit Garten eine neue Form von Freiheit, auch wenn sie sich weiterhin Zimmer teilen mussten: „Wir hatten drei Kinderzimmer, eines für meine älteste Schwester, eines für die drei Brüder und eines für uns restliche drei Töchter." Selbstverständlich trug man das Gewand der älteren Geschwister nach, was nicht immer angenehm war: „Vor allem die Eislaufschuhe taten furchtbar weh!"
Ihre Eltern haben wenige Jahre später das Nachbargrundstück erworben, auf dem sie und ihr Mann vor zwei Jahrzehnten ihr Haus errichteten, in dem wir unser Gespräch führen. „Da ist eine Brücke über den Ragnitzbach und im Haus jenseits des Baches (schon im Bezirk Ries) bin ich aufgewachsen." In ihrer Kindheit, erinnert sich Reithofer-Haidacher, sei die Gegend nur sehr schlecht erschlossen gewesen: „Wo sich jetzt der Berliner Ring befindet, war ein riesiges Kukuruzfeld. Es gab nur ein kleines Lebensmittelgeschäft und es fuhr nur der Postbus." Da sie und ihre Geschwister Schulen in der Innenstadt besuchten, fuhr sie ihr Vater, der eine Rechtsanwaltskanzlei am Tummelplatz betrieb, in die Schule: „Mein Vater hatte einen Mercedes und es war damals erlaubt, - weil jedes Kind nur als halbe Person gegolten hat - mit allen sieben Kindern im Auto zu fahren!"
Als Studentin an die Elfenbeinküste
Nach ihrer Gymnasialzeit begann Reithofer-Haidacher ein Deutsch- und Geschichtestudium, das jedoch nicht ihre Erwartungen erfüllte. So wechselte sie zur Studienrichtung Medien und „Fächerbündel". Als sich im Jahr 1983 die Chance bot, mit anderen ein halbes Jahr lang an der Elfenbeinküste in einem Missionsspital mitzuhelfen, nahm sie diese sofort wahr. Nach dieser für sie sehr prägenden Zeit („Die Afrika-Liebe hat mich bis heute nicht verlassen!") begann sie neben dem Studium als Journalistin bei der sozialdemokratischen Tageszeitung „Neue Zeit", von wo sie später als fix angestellte Redakteurin zur katholischen Wochenzeitung „Sonntagsblatt" wechselte. Erst viele Jahre später, im Jahr 2015, schloss sie ihr Studium Medienkunde ab, das mittlerweile ein Masterstudium geworden war.
Vom „Sonntagsblatt" zur Wahlkämpferin
Nachdem neun Jahre beim „Sonntagsblatt" („Ich habe in dieser Zeit auch meine beiden Töchter bekommen.") vergangen waren, war es für Reithofer-Haidacher Mitte der 1990er-Jahre an der Zeit für etwas Neues. Nach ihrer Arbeit bei einem Biobauernverband stieg sie bei den Grazer Grünen als Kampagnenmanagerin und Zuständige für die Öffentlichkeitsarbeit ein: „In den neun Jahren dort habe ich an 13 Wahlkämpfen mitgewirkt!" Über die Jahre hätte sich die Art, wie Parteien ihre Wahlkämpfe führen, massiv verändert. „Als ich begann, arbeiteten die Grünen zum ersten Mal mit einer Agentur zusammen. Im Wahlkampf davor hatten sie noch handgemalte Plakate aufgehängt. Ich war die erste in meinem gesamten Umfeld, die 1998 ein Handy hatte. Ich wusste gar nicht, mit wem ich telefonieren soll!"
Vor allem das Marketing habe sich seit damals sehr professionalisiert. Reithofer-Haidacher: „Mir kommt vor, vielleicht ist das die Verklärung des Alters, dass früher die Inhalte schon viel wichtiger waren." Im Unterschied zu heute, wo Wahlplakate auf das Erscheinungsbild der Spitzenkandidat:innen zugeschnitten seien, hätte es zu ihrer Zeit einen Spitzenkandidaten gegeben, dem seine Inhalte viel wichtiger als seine Optik waren. Als einige innerhalb der Partei vorschlugen, den Politiker für seine öffentliche Auftritte einzukleiden, „ist das radikal abgelehnt worden: ‚Das ist ein Eingriff in seine Persönlichkeit. Er soll sich frisieren und anziehen, wie er will!‘"
Die Frau vor der Stadtpfarrkirche
Da sie die Arbeit als Journalistin vermisste, war Reithofer-Haidacher ab dem Jahr 2006 für sechs Jahre als Redakteurin bei der Straßenzeitung „Megaphon" tätig. Mit einigen der ehemaligen Megaphon-Verkäufer:innen ist sie bis heute befreundet.
Wir fragen Reithofer-Haidacher, ob sich die Arbeit an einem Artikel besonders eingeprägt habe: „Ja, es gibt eine Roma-Frau, die bis heute vor der Stadtpfarrkirche sitzt, im Rollstuhl. Über sie und ihre Mutter habe ich einen Artikel geschrieben." Daraufhin seien erfolgreich Spendengelder gesammelt worden, um sie im Spital zu operieren. „Das Ganze ist leider daran gescheitert, dass die Frau gern ihre Mutter im Spital dabei gehabt hätte. Aber die Spitalsleitung hat es verboten. Daraufhin wurde die Operation abgesagt, nach der sie hätte gehen können. Sie sitzt bis heute dort in der Herrengasse und bittet um Geld."
Das eigene Haus für Geflüchtete geöffnet
Noch während ihrer Tätigkeit beim „Megaphon" entschloss sich Reithofer-Haidacher im Jahr 2008, nach dem Auszug der älteren Tochter, beim Projekt „Connecting People" des Vereins „Zebra" teilzunehmen, in dem man den Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen lernen und sich untereinander austauschen konnte. „Ich bin eher ein mütterlicher Typ und wollte mich Jugendlichen widmen, die hier keine Eltern haben." Nachdem ein Kinderzimmer frei war und es auch für ihren Mann und die jüngere Tochter in Ordnung ging, fragte Eva Reithofer-Haidacher einen jungen Afghanen, der in seinem Asylquartier aufgrund Mobbings unglücklich war: „Möchtest du zu uns ziehen? Er hat sofort ‚Ja!‘ gesagt und dann eineinhalb Jahre bei uns gewohnt."
Als im Jahr 2015 syrische Flüchtlinge nach Graz kamen, nahm die Familie Reithofer-Haidacher - inzwischen waren beide Kinderzimmer leerstehend - einen syrischen Flüchtling samt dessen neu angekommener Frau und dreijähriger Tochter vorübergehend bei sich auf. So konnte die Familie zusammenbleiben, statt auf unterschiedliche Flüchtlingsquartiere aufgeteilt zu werden. Reithofer-Haidacher: „Bis heute haben wir mit ihnen ein enges Verhältnis, vor allem mit der Tochter, die inzwischen das Gymnasium besucht. Sie kommt bis heute gerne zu uns und fährt mit uns auf Urlaub." Reithofer-Haidacher verschweigt aber nicht die mitunter anstrengenden Veränderungen durch neue Mitbewohner:innen, noch dazu, wenn zu Beginn eine gemeinsame Sprache fehlte und man sich nur „mit Händen und Füßen verständigen konnte. Das war eine Herausforderung. Wir haben dann immer am Abend über unser tägliches Missverständnis gelacht!" Aus geplanten wenigen Wochen wurden neun Monate, bis die asylberechtigte Familie aus Syrien eine eigene leistbare Wohnung finden konnte.
Unterkünfte für ukrainischen Vertriebene
Mit 13 Jahren am bisher längsten ist Reithofer-Haidacher bei „LebensGroß" angestellt, wo sie eine Dekade lang die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit leitete. Nach Ausbruch des Ukrainekriegs übernahm Reithofer-Haidacher die Betreuung der Quartiere für ukrainische Flüchtlinge. Die verbliebenen 14 kleineren Quartiere werden von Familien genutzt, da - wie Reithofer-Haidacher betont - „in der ersten Kriegszeit bei Familien mit drei oder mehr Kindern noch die Väter mitausreisen durften."
Bereits im März 2022 wurden sie und ihr Mann privat aktiv: „Bei einer Demonstration hörten wir einen emotionalen Aufruf, Leute aufzunehmen, die ab nächster Woche massenhaft kommen." Nur wenige Tage später fand eine 68-jährige ukrainische Englischlehrerin für einige Monate bei ihnen Platz. Aus ihren Erfahrungen habe sie gelernt, so Reithofer-Haidacher, „dass man sich der Tragweite einer solchen Entscheidung bewusst sein müsse. Man muss genau sagen, von wann bis wann und unter welchen Bedingungen man jemanden beherbergt.
Alles in allem fällt das Resümee für ihr bewundernswertes privates Engagement positiv aus: „Ich habe immer irgendwas Wesentliches mitgenommen und in mein Leben integriert!"



An der Grazer Stadtgrenze befindet sich in der Riesstraße 351 die Waldorfschule Karl Schubert, eine Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht und Klassen von der 1. bis zur 12. Schulstufe und einem gestaffelten Schulbeitrag. Die dort praktizierte Waldorfpädagogik basiert auf den Erkenntnissen von Rudolf Steiner, der 1919 in Deutschland seine erste Schule eröffnete und an welcher Karl Schubert, Namensgeber der Grazer Schule, heilpädagogisch tätig war.
Erste inklusive Waldorfschule Österreichs
Die 57-jährige Lehrerin Barbara Nickel-Denk ist seit 1996 an diesem Standort tätig, an dem man 1990 im ehemaligen Kainbacher Gemeindeamt mit dem Unterricht begann. Speziell am Schulstandort ist außerdem, dass alle Klassen inklusiv geführt werden und es daneben noch drei rein heilpädagogische Kleinklassen gibt. „Wir waren ganz lange Jahre die einzige wirklich inklusiv arbeitende Waldorfschule in Österreich," erzählt Nickel-Denk stolz, die noch schnell mit einem Schulkind abzuklären hat, von wem es abgeholt wird. Nun sitzen wir allein in einem der Klassenzimmer, das sich im Aussehen klar von Regelschulen abhebt. „Wir sind hier im Raum der sechsten Klasse. Der ist von den Wandfarben her ein bisschen kühler, ins Grün-Blau gehend. Wenn man in die erste Klasse geht, ist die rot. Die zweite ist orange und die dritte ist gelb." Neben dem sich ändernden Farbkonzept ist die Raumhöhe in dem in den 1990er-Jahren neu errichteten zusätzlichen Schulgebäude an das Alter der Kinder angepasst. Nickel-Denk erklärt: „Von Klassen mit sehr warmen und umhüllenden Formen und entsprechenden Farben kommt man in diese höheren Räume. Da muss man schon ein bisschen freier und selbstständiger in die Welt schauen." Die Lehrerin kann sich noch an die Anfangszeit der Schule erinnern: „Vor 37 Jahren habe ich während meines Studiums ein Jahr unterrichtet, da gab es dieses Gebäude noch nicht. Hier standen Stallgebäude, die weggerissen wurden. Dort, wo jetzt unser Festsaal ist, war ein Parkplatz."
Ein früher Wunsch nach einer anderen Art von Schule
Noch bevor sie in Graz und Wien Germanistik und Geschichte studierte, kam Nickel-Denk nach der Matura durch ihre Familie mit der Waldorfpädagogik in Berührung. Damals kam ihre 13 Jahre jüngere Schwester in die erste Grazer Waldorfschule in Messendorf: „Ich und mein jüngerer Bruder haben das sehr toll gefunden, dass sie in eine andere Schule geht als wir. Ich habe vor allem immer mitgelitten mit Schüler:innen, die bei einer Prüfung den Mund nicht aufgebracht haben und dann schlecht behandelt wurden." Schon während ihrer Studienzeit besuchte sie Sommerkurse in Stuttgart und erlebte dort langjährige Waldorflehrer:innen, „die viele Bücher verfasst haben, die noch immer in Gebrauch sind". Da sie sich schon immer für Musik und Gesang interessiert hatte, absolvierte sie an der Grazer Musikhochschule einen Kurs für musikalische Früherziehung. Weil man in der Waldorfpädagogik, so Nickel-Denk, ebenfalls „immer künstlerisch tätig ist, war das schließlich mit ein Grund, warum ich mich entschieden habe, dass ich das machen möchte".
Für ein soziales Miteinander
Nickel-Denk, deren drei Kinder ebenfalls alle hier in die Schule gingen, ist noch immer eine begeisterte Lehrerin: „Man muss die Kinder gernhaben und darf das nicht als Job, sondern bis zu einem gewissen Grad als Lebensinhalt sehen. Man muss offen sein für das soziale Miteinander, weil wir keine hierarchisch strukturierte Schule sind." So werden viele Entscheidungen von einer „Schulführungskonferenz" oder dem gesamten Lehrer:innenkollegium entschieden.
Für die angestrebte Inklusion seien kleine Klassengrößen notwendig und eine Arbeit im Team mit heilpädagogischen Mitarbeiter:innen. Nickel-Denk: „Wir haben verschiedenste Beeinträchtigungen bei unseren Schüler:innen, die als Inklusionsschüler:innen in den Klassen sind. Es kommt darauf an, dass das Klassenganze eine Gruppe ist, die gut führbar ist. So kann auch ein schwer beeinträchtigtes Kind, das viel aufnehmen kann, sehr gut aufgehoben sein in so einer Klasse." Da auf die Individualität der Inklusionsschüler:innen geachtet werde, gäbe es keine fixen Regeln zu deren Verteilung. „Es gibt Klassen, mit fünf Inklusionskindern und Klassen mit nur einem einzigen."
Den Kindern, die aus einem sehr großen Einzugsgebiet zur Schule kommen, solle die Möglichkeit gegeben werden, „ihre Kräfte zu entdecken und entfalten". Um dies zu erreichen, brauche es die Eigeninitiative der Schüler:innen: „Wir stehen nicht vor der Klasse und sagen, was bei der Prüfung kommt. Wir erarbeiten etwas gemeinsam und versuchen immer, die Kinder und Jugendlichen mit etwas anzusprechen, was mit ihnen als Menschen zu tun hat." Eine der dabei eingesetzten Methoden sei das „Epochenlernen": „Wir haben zum Beispiel drei bis vier Wochen Geografie, dann drei bis vier Wochen Geschichte. In der Früh gibt es immer diese Projekte." Danach folgen die regelmäßig unterrichteten Fachstunden, wie etwa Deutsch, Mathematik und Sprachen, aber auch handwerkliche Fächer. Zusätzlich gibt es ab der 6. Klasse wöchentlich zwei Stunden, in welchen die Schüler:innen gärtnerisch tätig sind. „Im Winter stellen sie Kräutersalz her, aus den Kräutern, die im Herbst geerntet wurden."
Kein internettaugliches Handy für 10-Jährige
Sehr wichtig für Nickel-Denk, von der eine auf der Tafel kunstvoll mit Kreide gemalte Landkarte Europas stammt, ist, dass viel mit der Hand geschrieben und gezeichnet werde. Die Schüler:innen stellen so ihre eigenen „Schulbücher", die sogenannten Epochenhefte her. „Man kommt immer mehr drauf, dass das nicht funktioniert, wenn Menschen lesen und schreiben lernen sollen, ohne je mit der Hand zu schreiben." Es gebe bereits die Tendenz einer Rücknahme der allzu frühen Digitalisierung in Bildungseinrichtungen, wie beispielsweise in Schweden, wo alle Kindergärten mit Bildschirmen ausgestattet werden mussten, was nun teilweise zurückgefahren wird. Nach Überzeugung der Waldorfschule sei für die digitale Mediennutzung ein gewisses Alter nötig. „Wir glauben, dass es ganz wichtig ist, einem Kind eine möglichst bildschirmfreie Kindheit zu ermöglichen." Das werde den Eltern schon bei den Aufnahmegesprächen vermittelt. „Nur wenn ein Kind seine Wahrnehmung umfassend im Analogen bildet, kann es sie echt entfalten." Daher würden in ihrer Klasse viele Kinder nur ein Tastenhandy besitzen und bei jenen mit einem internettauglichen Handy sei der Konsum zeitlich eingeschränkt. Erst mit etwa 14 Jahren würden Jugendliche nach Ansicht von Nickel-Denk die Fähigkeit bekommen, zu verstehen, was Medien mit ihnen machen. Diese Ansicht habe nichts mit einer Technikfeindlichkeit zu tun, gibt es doch auch Newsgroups mit den Eltern und E-Mail-Verteiler für die ganze Schule. Es gehe vielmehr darum, dass Kinder erleben sollen, wie man diese Medien sinnvoll einsetzt.
Ebenso entschieden sei man bei Eltern, deren Bereitschaft zu einer Erziehungspartnerschaft mit der Schule gar nicht gegeben ist. Nickel-Denk: „Man muss sich manchmal trennen von jemandem, weil man das Gefühl hat, das Kind wird nur abgegeben. Dann muss man sagen, nein, das hat für das Kind keinen Sinn und sie sollen sich was anderes suchen."
Das Ablegen der Matura erfolgt extern
Die eigentlichen Waldorfzeugnisse sind verbale Zeugnisse, die die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen beschreiben. Doch sei vor allem den älteren Jugendlichen „klar zu vermitteln, wenn die Leistung nicht passt." Die Ablegung der Matura nach Abschluss der 12. Schulstufe in der Waldorfschule ist nur extern möglich, etwa in einer eigenen Klasse im BORG, die nur mit Waldorf-Schüler:innen geführt werde. Immer mehr würden sich jedoch für die Abendschule entscheiden, wo mit dem nötigen Einsatz innerhalb von einem halben Jahr die Matura gemacht werden könne. Gerade Waldorf-Schüler:innen komme das laut Nickel-Denk entgegen: „Das Modul-System dort entspricht ein bisschen unseren Epochen-Projekten. Außerdem sind sie dort unter Menschen, die aus einem inneren Antrieb heraus die Matura machen wollen."
Kein Platz für mehr Schüler:innen
An der Waldorfschule werden aktuell rund 200 Schüler:innen unterrichtet, wobei viele davon zuvor schon den angegliederten Kindergarten besucht haben. Vielen Interessierten müsse deshalb mittlerweile abgesagt werden. Eine Vergrößerung scheint auch in Zukunft schwer möglich, da man aufgrund der Flächenwidmung des Geländes keine weiteren Gebäude dazubauen dürfe. So sei der letzte Neubau hier im Freiland nur deshalb bewilligt worden, da es im Raum Graz einen Mangel an Bewegungsstätten gibt. Nickel-Denk: „Das ist insofern toll, als wir einen sehr schönen Turnsaal haben. Aber wir haben immer noch zwei Klassen im Container. Da dürfen wir nichts anderes hinstellen oder sie durch ein Gebäude ersetzen. Wir sind daher immer am Umgestalten, um unsere 12 Klassen irgendwie unterzubekommen."
Und wie ist es persönlich für Sie, die nun schon mehrere Jahrzehnte lang als Lehrerin tätig ist? Ist man da der Kinder schon etwas überdrüssig? Nickel-Denk verneint vehement: „Nein, die Kinder reichen mir nicht! Und ich merke, wenn man älter ist, dann hat man eine gewisse Erfahrung. Ich mache alles immer wieder anders. Ich kann auch nicht nach Rezept kochen, sondern muss immer wieder etwas Neues ausprobieren!"



Im Jahr 2023 feierte die Grazer Berufsfeuerwehr ihr 170-jähriges Bestehen. Im Gegensatz dazu kam es erst 2008 zur Neugründung einer Freiwilligen Feuerwehr (FF Graz), die zuvor nur um 1850 für einige Jahre Bestand hatte. Seit 2009 dient die umgebaute, frühere Berufsfeuerwehrwache Kroisbach in der Mariatroster Straße 37 der FF Graz als Hauptstützpunkt.
Macht es überhaupt Sinn, wenn in Städten Berufsfeuerwehren und Freiwillige Feuerwehren nebeneinander bestehen? Da der höchste Kostenfaktor bei Berufsfeuerwehren deren Personalkosten seien und ein Blick auf die Einsatzstatistiken zeige, dass deren vorhandenes Personal nicht ausreiche, „haben wir über die Jahre mitbekommen, dass wir gebraucht werden und die Kollegen von der Berufsfeuerwehr sehr entlasten können. Ich glaube, der Grazer Bevölkerung ist es relativ egal, wer von uns kommt, wenn zum Beispiel der Keller überflutet ist." So die profunde Sicht von Feuerwehrgruppenkommandantin Sarah Schiller, die uns an diesem regnerischen Tag in der Feuerwache empfängt und uns im Gespräch ihre Liebe zur Feuerwehr spüren lässt. Mit dabei ihr erst wenige Monate alter Sohn, auf dessen Strampelanzug in großen Lettern das Wort „Feuerwehr" zu lesen ist.
Es war Schicksal
Sarah Schiller wurde im Frühjahr 1990 in Merseburg an der Saale geboren. „Ein halbes Jahr war es noch der ‚Osten‘, dann kam die Wiedervereinigung. Und als ich zwei Jahre alt war, zogen meine Eltern ins kärntnerische Arnoldstein, da mein Vater dort einen Job bekommen hatte." 2008 übersiedelte sie für ihr Chemiestudium nach Graz und fand im Student:innenheim in der Schönbrunngasse eine Bleibe.
Neben ihrem Studium war sie auf der Suche nach einer ehrenamtlichen Aktivität, ohne genau zu wissen, was das sein könnte. Eines Tages im Februar 2014 sah sie dann „im Internet etwas über Feuerwehren und in der Nacht darauf habe ich davon geträumt". Als sie am nächsten Morgen zur Grazer Feuerwehr recherchierte, stellte sie fest, dass die Wache gleich um die Ecke lag. Dass sie durch diesen Zufall ihre Liebe zur Feuerwehr entdeckte, empfindet sie in der Rückschau als eine Fügung des Schicksals.
Ab da ging alles sehr schnell: Sie ging zur Feuerwache und füllte ein Aufnahmeformular aus. Der Aufnahmeausschuss tagte zwei Tage danach und schon war sie aufgenommen. „Sie haben mich zu einer Übung mitgenommen und seitdem war ich eigentlich fast jeden Tag hier." Was ihren Einsatz betrifft, „so bin ich ein Extrembeispiel. Ich habe Jahre gehabt, da habe ich über 2000 Stunden hier verbracht, dieses Jahr komme ich trotz Schwangerschaft und Geburt immer noch auf rund 1000 Stunden." Im Durchschnitt liegt der Aufwand von Mitgliedern der Grazer Freiwilligen Feuerwehr bei 200 bis 500 Stunden pro Jahr, auch da es „12-Stunden-Nachtdienste gibt und bei diesen geht schon einiges an Zeit drauf".
Erst seit 2023 geschlechtergetrennte Umkleideräume
Auf ihre Grundausbildung folgten für Schiller Fortbildungen, die speziell für urbane Einsätze in Graz entwickelt wurden. Zu den häufigsten Einsatzbereichen gehören die Straßenreinigung nach Verkehrsunfällen, die Baum- und Astentfernung nach Stürmen, das Kellerauspumpen und Liftrettungen. Durch die hohe Anzahl von über 1000 Grazer Brandmeldeanlagen kommt es häufig zu Alarmen: „Es kann sein, dass es tatsächlich brennt, oder es raucht jemand oder zu Semesterbeginn in Student:innenheimen fangen die Leute zu kochen an. Es ist immer spannend, zu raten, welches Essen statt dem Verbrannten hätte werden sollen."
Bald interessierte sich Schiller bei der FF Graz für den Bereich des Atemschutzes: „Ich habe den Atemschutzgeräteträgerlehrgang in Lebring gemacht und wurde Atemschutzwart. Ich habe die große Verantwortung in der Feuerwehr, dass diese Geräte immer einsatzbereit sind."
Als Gruppenkommandantin einer rund 30 Mitglieder umfassenden Gruppe steht sie zudem an der Spitze der weiblichen Mitglieder der FF Graz. Im Unterschied zur rein männlichen Grazer Berufsfeuerwehr stellen Frauen bei der FF Graz etwa ein Fünftel der Belegschaft. „Wir sind zum Glück eine Wehr, die Gleichberechtigung lebt." Dennoch gab es bis zum Umbau 2014 in der übernommenen Berufsfeuerwehrwache keine getrennten WCs und Duschen. „Vorher hängten wir draußen Schilder hin, dass gerade Männer oder Frauen duschen. Getrennte Umkleiden waren logischerweise der nächste Schritt. Bis zur Eröffnung der Damenumkleidekabine im Jahr 2023 haben wir Frauen uns in der Fahrzeughalle umgezogen. Die Abmachung mit dem Bezirksamt ist nun, dass wir einen Raum dafür vom Bezirksamt bekommen haben - das gelang auch dank Unterstützung der Grazer Bürgermeisterin. Im Jahr 2023 kann es eigentlich nicht sein, dass es keine Möglichkeit zum getrennten Umziehen gibt."
Noch nicht ganz überwundene Geschlechterklischees
Seit 2021 ist Schiller als Ausbildnerin in der Feuerwehrschule in Lebring tätig und somit unter rund zwei Dutzend Ausbildner:innen die erste und einzige Frau in der Steiermark. „Zum Glück wurde das von den steirischen Feuerwehren sehr gut aufgenommen. Den meisten ist es egal, ob eine Frau oder ein Mann sie ausbildet." Natürlich gäbe es jene, die anfangs etwas skeptisch sind, etwa wenn es um den Einsatz von Körperkraft geht. „Meine Antwort darauf ist: Wir sind nie allein und der Vorteil der Feuerwehr als Gruppe ist die Einheit. Wenn ich nicht die Kraft habe, habe ich vielleicht die Technik oder das Wissen, um es leichter hinzubekommen. Es wird schwierig, klar. Aber dafür trainiere ich, dass ich die Kraft habe. Als ich den Atemschutzgeräteträgerlehrgang gemacht habe, war das für mich körperlich sehr anstrengend und eine extreme Herausforderung, die ich gemeistert habe. Was ich in meinen Jahren als Ausbildnerin beobachtet habe, ist, dass Frauen immer glauben, sie schaffen es nicht. Aber da sie sich vor den Männern nicht bloßstellen wollen, haben sie einen größeren Ehrgeiz und entsprechend strengen sie sich erfolgreicher an. Als erste Ausbildnerin ist es toll, den Frauen in der Ausbildung zu zeigen: ‚Wir können das und kein Mensch kann dir sagen, dass du das nicht kannst!‘" Dass anlässlich des letzten Internationalen Frauentags ein Posting auf Social Media dessen Bedeutung betont hat, ist daher keine Überraschung.
Mariatrosterin und Mutter
Seit einigen Jahren wohnt sie in Mariatrost und nutzt so den Vorteil, im Ernstfall schneller auf der Wache sein zu können. Durch ihr Baby hat sich der Blick auf ihren Stadtteil verändert. Fiel ihr bereits früher auf, dass Personen mit Rollstühlen, die in einer Einrichtung in der Nähe der Basilika wohnen, schwer auf den Gehsteig hinaufkommen, so macht sie mit dem Kinderwagen nun ähnliche Erfahrungen. Ein weiterer Wunsch von ihr ist, dass es in der Stadt mehr Wickelmöglichkeiten gibt, damit man sein Baby nicht am Boden wickeln muss.



Seit über 60 Jahren wohnt die 93-jährige Erika Jurkovič in ihrem Haus in Andritz. Beim Eintreten gilt es, schnell die Türe zu schließen, sollen doch ihre Katzen Maxi und Leni und Hündin Peggy im Haus bleiben. Auf dem Wohnzimmertisch, der im Zentrum ihrer täglichen Aktivitäten steht, stapeln sich Tageszeitungen, Journale und Hefte von Tierschutzorganisationen. Bald diskutieren wir über aktuelle Themen, die ihr beim Durchlesen der beiden abonnierten Tageszeitungen untergekommen sind. Ihre große Liebe gilt jedoch autobiographischen Romanen, von welchen sie fast wöchentlich einen verschlingt. Das mag wohl daran liegen, dass ihr eigenes Leben sich wie ein Schicksalsroman anhört.
In der slowenischsprachigen Volksschule
Als sie am 4. Jänner 1931 in Maribor (Marburg) als Erika Hetzl geboren wurde, war die Stadt seit über 10 Jahren ein Teil Jugoslawiens. Bald wurde ihr Vater als Mitarbeiter der Bahn nach Ljubljana versetzt und die Familie kam mit. „Dort im Kindergarten lernte ich slowenisch, während wir zu Hause Deutsch gesprochen haben." Als Erika vier Jahre alt war, verstarb ihre Schwester mit einem halben Jahr an Kinderlähmung. 1935 zogen sie zurück und „da habe ich mit der slowenischsprachigen Volksschule angefangen. Diese Schule am Toppeinerplatz existiert heute noch!" Da sie im damals noch nicht eingemeindeten Ort Košaki wohnte, konnte sie nicht die deutschsprachige Schule besuchen, für die man in der Stadt wohnen musste. „Am 2. November 1940 verstarb mein Vater an einem Herzinfarkt mit 49 Jahren. Plötzlich stand meine Mutter mit 37 Jahren mit mir allein da und musste außerdem meine schwerkranke Großmutter pflegen."
Evakuierung der Schule
Nach der NS-Machtergreifung und der Einverleibung Sloweniens in das Deutsche Reich im Jahr 1941 wurde der Schulunterricht nur mehr auf Deutsch abgehalten. Aufgrund des Kriegsverlaufs wurde ihre Hauptschule 1944 nach Radenci (Bad Radein) verlegt. Zu Ostern 1945 mussten die Schülerinnen wegen der näherkommenden Front wieder ihre Koffer packen „und wir sind mit dem Zug bis zum Bahnhof Au-Seewiesen gefahren". Von dort ging es zu Fuß rund 30 Kilometer bis zum Erlaufsee. Nach nur wenigen Wochen erfolgte eine weitere Evakuierung, diesmal an den Kärntner Millstätter See. Kurz vor Kriegsende im Mai 1945 holte ihre Mutter sie ab und sie fuhren gemeinsam in die slowenische Heimat.
Internierung im Lager Sterntal
Nach dem Ende des Krieges wurde Slowenien 1945 Teil der neu entstandenen Föderativen Volksrepublik Jugoslawien. In Košaki riet ein Nachbar ihrer Mutter zur Flucht, da nach den Jahren der NS-Diktatur die Situation für Deutschsprachige „gefährlich werden könnte. Aber meine Mutter sagte, sie bleibt da, sie hat ja niemandem etwas getan." Einige Wochen später wurden Erika, ihre Mutter und weitere Verwandte von Košaki aus in das jugoslawische Internierungslager Sterntal (Taborišče Šterntal) gebracht. Das Lager befand sich in der Nähe von Ptuj (Pettau), wo von den Nationalsozialist:innen während des Krieges Zwangsarbeitende einer Aluminiumfabrik in Baracken untergebracht waren. „Das Lager war mit einem Zaun geteilt. Wir kamen in eine Baracke im unteren Teil des Lagers. Dort waren viele unserer Bekannten." Es ist Erika Jurkovič, die damals 14 Jahre alt war, anzumerken, wie schwer es ihr fällt, über ihre Erlebnisse im Lager zu erzählen.
Ohne Mutter zurück in Maribor
Im Oktober 1945 wurde das Lager in Sterntal aufgelöst. „Wir Kinder wurden entlassen und nach Hause geschickt. Wie ich nach Hause kam, sind gerade fremde Leute in unser Haus eingezogen, und ich konnte nur etwas Gewand zum Anziehen und einige Fotoalben und Fotos herausholen und ging zu meiner Tante in Maribor." Ihre Mutter jedoch, die sie zuletzt im Lager Sterntal sah, soll - wie sie später erfuhr - vor ein Gericht gekommen und in ein weiteres Lager Nahe Maribor gebracht worden sein.
Als es im Jänner 1946 wieder zu Verhaftungen kam, war darunter ihre Tante, bei der sie wohnte. Zwar musste Erika nicht mit, aber „einige Tage später holte mich ein Partisan ab und brachte mich in die ehemalige Obstbauschule Gams (Kamnica)".
29. März 1946: Ausreise nach Österreich
„Ich selbst kam am 29. März 1946 mit anderen über die österreichische Grenze. In der Kaserne in Strass wurden wir gewaschen und entlaust." Nach 14 Tagen wurden sie aus der Quarantäne entlassen. Da man ihr in Slowenien versichert hatte, dass ihre Mutter bereits in Österreich sei, suchte sie bei Verwandten, zuerst in Kärnten, dann in Graz, nach ihr.
Sie kam bei ihrem Onkel Josef Weitzl unter, in dessen „Alpenländischer Kraftfahrschule und Reparaturwerkstätte" am Griesplatz 16 sie ihre Lehre zur Bürokauffrau absolvierte. Erst Jahre später musste sie die Hoffnung aufgeben, ihre Mutter wiederzusehen. Eine noch in Slowenien lebende Verwandte überbrachte die Nachricht, dass das Lager, in dem ihre Mutter gewesen war, aufgelöst worden war und die Lagerinsass:innen am Bachern erschossen worden waren.
Geschäftsgründung und Hauskauf
Ihren Mann heiratete sie 1958 und ein Jahr später kam Sohn Harald zur Welt. Schon vor der Heirat hatte sie die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten, die es ihr erlaubte, wieder nach Jugoslawien zu reisen.
1961 eröffnete sie mit ihrem Mann am Kaiser-Franz-Josef-Kai das Geschäft „Fernsehgeräteschau". „Damals waren Fernseher eine Rarität und wir haben, neben drei bis vier anderen Geschäften in Graz, mit dem Verkauf angefangen und es war ein gutes Geschäft." Daneben sollten die im ersten Stock aufgebauten Stereoanlagen Kund:innen für das neuartige Klangerlebnis begeistern.
Nur wenige Jahre nachdem sie 1963 in Andritz ein Haus gekauft hatten, verstarb ihr Mann Harald Jurkovič überraschend mit 37 Jahren am 9. Mai 1969 an einer Sepsis. „Das war der Tag, an dem Königin Elisabeth in Graz war." Erst wenige Tage zuvor war er am 5. Mai, seinem Geburtstag, mit großen Schmerzen ins Spital eingeliefert worden. „Es war gerade die Grazer Messe, wo wir einen Verkaufsstand hatten. Einen Tag hatten wir geschlossen, dann ging die Arbeit weiter."
Nach dem Tod ihres Mannes führte sie das Geschäft allein weiter, bis sie es an eine Schwester von Helmut Marko übertrug (später, nach dem Tod der Hausbesitzerin, erwarb Helmut Marko, der bereits das Nebenhaus besaß, auch dieses Haus, um es in ein Hotel umzuwandeln).
Selbständiges Wohnen - solange es geht
Ab 1981 arbeitete sie bei den Minoriten, wo sie bis zu ihrer Pensionierung 1991 für das Rechnungswesen und die Buchhaltung verantwortlich war. „Damals war noch die Musikhochschule dort untergebracht, bevor sie in die Leonhardstraße umgezogen ist."
Es ist faszinierend zu sehen, wie Erika Jurkovič Pläne für die Zukunft schmiedet. So hat sie in ihrem Garten in den letzten Jahren einige neue Obstbäume gepflanzt. „Das sind zwei Apfelbäume, ein Weingartenpfirsichbaum und ein Kastanienbaum, den ich umgesetzt habe. Einen Kirschbaum habe ich auch gesetzt, aber der braucht noch einige Zeit, bis er Früchte trägt." Die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, in ein Altersheim zu ziehen, entrüstet sie sichtlich. „Ich liebe mein Haus, meine Tiere und will nicht in ein Altersheim, das mache ich nicht. Ich möchte zuhause sterben!"



Walter Bradler steht am Balkon seiner Wohnung am Ende einer Abzweigung der Göstinger Straße, von welchem ein großer Teil der Stadt überschaubar ist. Beim Anblick des Nachbargrundstücks, auf dem das sogenannte Plabutscher Schlössl seit Jahren leer steht und sich auf der Wiese einige Rehe tummeln, wird er sentimental. Unter den Vorbesitzern standen hier noch viele alte Obstbäume, aus denen Schnäpse hergestellt wurden. Bis auf einige Kakibäume wurde alles gerodet. In der ganzen Umgebung kam es in den letzten 43 Jahren zu vielen baulichen Veränderungen, seit der damals 20-Jährige eine Garconniere suchte, da ihm sein Vater nahelegte, aus der beengten elterlichen Wohnung auszuziehen.
Aufgewachsen in einer Arbeiterfamilie
„Aufgewachsen bin ich, zusammen mit meinen zwei Schwestern, am Griesplatz in einer Substandardwohnung mit 45 Quadratmetern, ohne Bad und mit einem WC am Gemeinschaftsbalkon." In seiner Kindheit fuhr noch die mitunter laut rumpelnde 6er-Straßenbahn über den Griesplatz zum Zentralfriedhof. Mit mehreren Bäckereien, Fleischereien, Friseuren und Lebensmittelgeschäften war „der Platz ein eigener Mikrokosmos und du hast dich problemlos vor Ort versorgen können". Längst abgerissen ist die einstige Markthalle am nördlichen Ende des Griesplatzes, wo im Inneren Standler:innen ihre frischen Waren anboten und auch die frühere Fischhalle wird nun anders genutzt.
Ein sich ständig verändernder Beruf
Nach seiner Lehre zum Lithografen bei Dorrong arbeitete er für Jahrzehnte bei Reproteam und legte die sieben Kilometer zu seiner Arbeitsstätte in der Jauerburggasse von Beginn an mit dem Rad zurück. „In meinem Beruf hat es gleich mehrere Revolutionen gegeben, die das Berufsbild komplett veränderten. Bei Dorrong wurde der Text noch mit Bleisatz gesetzt. Danach, noch vor der Zeit von Computern, wurde der Fotosatz mechanisch angefertigt, indem der Text durch Schablonen belichtet wurde. Dann kam der Computer und bald darauf ist alles verschwunden. Diese Art der Arbeit gibt es heute nicht mehr." In den letzten 18 Jahren bis zu seiner Pensionierung 2021 war er in Webling beim Nachfolgeunternehmen der Firma Wall mit der Herstellung spezieller Druckplatten für Lebensmittel- und Zigarettenverpackungen beschäftigt.
Ein „Radlnarrischer mit einem Sammler-Gen"
Neben seiner Arbeit hat Walter Bradler über Jahrzehnte seine sogenannte Velorabilia-Sammlung aufgebaut. In zwei Kellerräumen finden sich in seinem Privatmuseum in schön ausgeleuchteten Vitrinen ungezählte Miniaturradmodelle, die bereits in einer TV-Sendung zu sehen waren. „Schon meine Mutter meinte, dass ich alles sammle, von dem es zumindest zwei verschiedene Exemplare gibt. Ich bezeichne mich selbst ja als ,Radlnarrischen mit Sammler-Gen‘." Am Wohnzimmertisch hat er für uns einige Ordner ausgebreitet, in denen ein kleiner Teil seiner Postkartensammlung zu bewundern ist. „Das Auge für schöne Grafiken hat sicher mit meinem Beruf zu tun. Werbegrafiken haben mich von der Gestaltung her immer fasziniert." Am Anfang seiner Postkartensammlung stand die Motivik des Fahrrades. Wie groß der Umfang dieser Sammlung aktuell ist, weiß er gar nicht so genau, doch schon vor Jahren „hatte ich rund 6.000 ältere und 6.000 neuere Postkarten mit Radmotiven". Die Produktion eines eigenen Buchs über seine Sammlung scheiterte bisher an den Kosten. So freut er sich aber, wenn er Exemplare seiner Sammlung zumindest für andere zur Verfügung stellen kann: „Alleine in einem neuen Buch über die Geschichte des Fahrradfahrens in Österreich sind 40 Abbildungen von mir zu finden!"
Im Einsatz für eine fahrradfreundliche Stadt
Seine ersten Radfahrerfahrungen machte Bradler auf einer „Rollerbahn" im Augarten. „Da gab es dort, wo jetzt die Bucht ist, eine asphaltierte Rundstrecke, wo wir Kinder mit unseren Rollern herumgefahren sind. Unser erstes gemeinsames Rad, von mir und meiner Schwester, war ein Puch Mini." Als Erwachsener blieb er dem Radfahren treu. „Ich hatte nie ein Auto, nicht einmal einen Führerschein. Für jemanden, der in Graz wohnt, ist es fast unnötig, mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Ich habe das Glück, dass meine Frau das genauso sieht."
Seine Ideen zur aktiven Mitgestaltung einer radler:innenfreundlichen Stadt kann er innerhalb der Radlobby ARGUS Steiermark umsetzen. Vor 25 Jahren wurde der steirische Zweigverein mit heute rund 600 Mitgliedern gegründet. „Ich bin seit Beginn an mit dabei und war zuvor schon Mitglied beim Wiener Verein ARGUS. Seit einigen Jahren bin ich ehrenamtlich im Vorstand tätig." Über die Erfolge der Radlobby meint er. „Wir haben kein Mandat, wir können nur Vorschläge machen. Aber ein Beispiel ist der Puchsteg:" Da die Pläne des Kraftwerksbetreibers vorsahen, den neuen Steg wieder gleich schmal wie den alten zu errichten, habe sich die Radlobby erfolgreich für die nunmehr breitere Variante eingesetzt. Die Stadt Graz steuerte finanziell etwas dazu bei.
Hauskaffee und Krapfen
Dass er neben seinen anderen Sammlungen zudem noch eine sehr imposante Ansichtskartensammlung mit tausenden Abbildungen zum Bezirk Gösting bzw. zu Graz besitzt, „hat mit der Bezirksausstellung 1989 zu tun, die im E-Werk Gösting zu sehen war". Nach deren Besuch begann er selbst zu sammeln. „Mich interessierte immer schon, wie etwas früher ausgesehen hat. Gösting war um 1900 noch ein Bauerndorf und der Bereich zwischen hier und der Stadt Graz noch völlig unverbaut." Ein besonderes Anliegen im Bezirk ist ihm die ungewisse Zukunft der Burgruine Gösting, wo man im Lokal bei Hauskaffee und Krapfen auf der herrlichen Terrasse einkehrte. „Vor allem am Wochenende sind Familien in Scharen hinauf gewandert. Es ist ein nahes und mit Öffis erreichbares Top-Ausflugsziel." Dem Verkauf an den letzten Besitzer stand er kritisch gegenüber, deshalb gab der Pachtvertrag mit der Stadt Hoffnung, dass zumindest irgendetwas geschieht. „Leider wurde schließlich nichts außer den notwendigen Sicherungsmaßnahmen umgesetzt." Allein schon aus Respekt vor einem der ältesten Gebäude von Graz bräuchte es dessen Erhaltung und Zugänglichmachung „und es braucht oben eine kleine Taverne, aber keinen Eventtempel! Der Platz ist, so wie er ist, sehr schön und wertvoll, deshalb hoffe ich sehr auf eine baldige Öffnung der Burg."
Als Pensionist ist für Bradler „alles nun viel entspannter. Ich genieße es sehr und kann es nur empfehlen, sage ich immer. Aber ich bin gerne arbeiten gegangen, bis zuletzt." Nachdem er früher im Schichtbetrieb gearbeitet hat, genießt er jetzt seinen Morgen und kann sich noch mehr seinen Sammlungen und Aktivitäten widmen.



Wir treffen die Diskuswerferin Djeneba Touré vor dem ASKÖ Stadion im Bezirk Eggenberg, deren Trainingsanlagen sie für ihren Sport exzellent nutzen kann. Wenige Minuten später steht sie mit ihrer Sportkleidung am Platz und zeigt uns ihre Würfe mit dem ein-Kilo-schweren Diskus. Ihre Stärke und ihr standhaftes Auftreten stellt die selbstbewusste 27-Jährige auch im folgenden Gespräch unter Beweis.
Gute Deutschkenntnisse bereits zu Beginn der Schule
Zusammen mit ihrer Mutter kam sie im Jahr 2000 im Alter von vier Jahren von der westafrikanischen Elfenbeinküste nach Graz, wo ihr Vater als anerkannter Flüchtling lebte. „Ich habe meine Mutter zu ihrem Deutschkurs begleitet und mit ihrem wenigen Geld haben meine Eltern mir deutschsprachige Bücher gekauft und daraus vorgelesen." Obwohl sie bereits gut Deutsch konnte, wurde sie in den ersten beiden Schuljahren in der Volksschule Graz St. Andrä, nicht benotet. „Später noch musste ich in der Schule als Kind mit Migrationshintergrund Deutschkurse besuchen. Ich dachte mir: ,Ich brauche das nicht, denn es gibt Österreicher, die können sicher schlechter Deutsch als ich.‘"
Unnötige Hürden am Weg zu einer Staatsbürgerschaft
Durch Bemühungen ihres Volksschuldirektors Loretto und ihrer guten Noten kam sie nach der Volksschule ins Lichtenfelsgymnasium. Etwa zur selben Zeit wurde ihr und ihrem Vater die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen. „Meine Mutter hat die Staatsbürgerschaft erst vor einigen Jahren bekommen. Da lebte sie schon über 20 Jahre hier, hat ihre Steuern gezahlt, war mit einem Österreicher verheiratet und hatte drei österreichische Staatsbürger:innen als Kinder. Trotzdem musste sie sich beweisen. Es kostet viel Geld und nicht alle haben die Bildung, um den nötigen Wissenstest zu schaffen."
„Alles, was eine Frau macht, ist weiblich!"
Im Gymnasium hatten die Sportlehrerinnen zwar ihr sportliches Talent erkannt, aber erst über ihre Mitschülerin, die sie zum Leichtathletiktraining im ATG begleitete, kam sie zum Diskuswurf. Der Erfolg stellte sich rasch ein mit guten Platzierungen bei der U-18-WM, U-20-WM und U-23-WM. Seit sie mit 23 Jahren in die allgemeine Klasse kam, ist sie in Österreich, wie sie stolz erzählt, die unangefochtene Nummer 1. Leider verpasste sie 2018 das Limit für die Teilnahme an der Europameisterschaft um mickrige 14 Zentimeter.
In der Vergangenheit war das Image von Diskuswerferinnen geprägt von sexistischen Klischees. Nur weil viele Diskuswerferinnen stärker sind als die meisten Männer, mache das den Sport nicht weniger ästhetisch oder weiblich. So Touré: „Eine Frau ist eine Frau, solange sie eine Frau ist - fertig! Es ist egal, wie muskulös oder burschikos sie sich präsentiert."
„Von der Liebe zum Sport alleine kann man nicht leben!"
Die Stadt Graz und das Land Steiermark unterstützen Touré bei guten Leistungen mit Förderungen, welche jedoch bei Weitem nicht ihre Ausgaben für Trainer:innen, Massage, Physiotherapie oder Trainingslager abdecken: „An die 4000 Euro kommen allein dafür im Jahr an Kosten zusammen". Für ihre Eltern, die ihre Sportbegeisterung schon in der Schule unterstützten, war es daher immer wichtig, dass sie ihre Tochter zum Lernen motivieren, damit es neben dem Sport einen „Plan B" gibt. Tourés Traum ist es, als Dolmetscherin im EU-Parlament oder bei der UNO zu arbeiten. Dafür studiert sie neben ihrer Sportkarriere an der Universität Graz Translationswissenschaften. Dem Bachelor, der beinahe geschafft ist, soll bald das Masterstudium folgen.
„Über die Erlebnisse mit Leuten könnte ich ein Buch schreiben."
Was „Integration" für sie bedeutet? Studien, so Touré, würden beweisen, dass Begegnungen im Alltag, etwa in soziokulturell vielfältigen Wohngebieten, zum Abbau von Vorurteilen beitragen. „Nähe bringt Verständnis und darum sollte man gratis Sportangebote für alle Kinder anbieten, egal welcher sozialen Schicht sie angehören. So kommen sie zusammen und die Eltern vielleicht auch. Natürlich ist das Integrationsthema relevant und man sollte es im Hinterkopf behalten, aber man kann es mal als Übertitel weglassen", damit daraus nicht gleich eine exkludierende Sonderbehandlung für Migrant:innen entsteht.
„Ich bin dreisprachig aufgewachsen und rede mit meinen Eltern Dioula und Deutsch. Dazu kommt noch Französisch. Ich finde es schade, dass viele Migrant:innen ihre Muttersprache nicht können, weil von den Kindern verinnerlicht wurde, dass diese keinen Wert hat." Alle ihre Anstrengungen und Kompetenzen bewahrten und bewahren sie nicht vor diskriminierenden Erfahrungen - vor allem aufgrund ihrer Hautfarbe: „Sie starren einen an oder reden dich auf Englisch an - dabei bin ich gar nicht anglophon! Dann immer diese Frage: ,Woher bist du?‘ Manchmal fragt man aus Interesse. Dann gibt es den Punkt, wo du denkst: ,Das spielt gar keine Rolle und ist bloß eine komische Frage.‘" Was sie sich stattdessen wünsche? „Ganz normale Fragen, so in der Art: ,Hi, wie heißt du, was machst du?‘"
Diese wiederholten Diskriminierungserfahrungen beeinflussen unbewusst ihr Verhalten. So war der erste Gedanke, als sie eines Tages im Winter an ihrem eingefrorenen Fahrradschloss herumhantierte: „Hoffentlich denkt niemand, ich stehle mein Rad." Über eine vorbeigehende ältere Dame, die fragte, ob es ihr „bei uns" gefällt, dachte sie sich: „Hallo, ich bin schon über 20 Jahre hier und österreichische Staatsbürgerin. Sicher hatte diese Frau es lieb gemeint, aber die Fragen nerven. Und was heißt das ‚bei uns‘? Ich bin auch hier bei mir, ich wohne auch da!" In dieser Stadt, wo es noch Menschen gibt, „die zu mir kommen und ‚Neger‘ sagen, einfach so, ohne Vorwarnung. Das passiert immer noch! Am helllichten Tag, in den Öffis, am Bahnhof und letztens am Grazer Hauptplatz."
Wann wäre ich stolz auf Graz?
Der Bezirk Eggenberg, in dem sie jahrelang wohnte und ihre Eltern heute noch wohnen, „ist praktisch, gut angebunden und daher irgendwie dezentral zentral". Zu den Veränderungen im Bezirk hat sie ihre eigene Sichtweise: „Die neuen Bauten in Reininghaus erinnern mich ein wenig an die Türme von Mordor - hoch, dunkel und nicht sehr ästhetisch. Ich finde es toll, dass eine Stadt sich bemüht, neue Wohnräume zu schaffen, aber ein Problem, das ich sehe, ist die Frage des leistbaren Wohnens." Bei Familien mit geringeren Einkommen würden sich die hohen Mietpreise nicht ausgehen und seien neu gebaute Wohnungen oft nicht leistbar. „Wie soll Integration funktionieren, wenn ich räumlich abgeschottet und dazu noch an einer Schule bin, von der alle sagen, es sei eine ‚Brennpunktschule‘?!"
„Wenn der Trend zu teuren Wohnungen, Öffis und Lebenserhaltungskosten gestoppt werden könnte, dann würde ich sagen: ,Auf diese Leistungen wäre ich stolz als Grazerin.‘"



In seiner Wohnung im Bezirk Wetzelsdorf erzählt uns Damien Crano, wie er nach seinem Studium im Jahr 2003 nach Graz kam, um hier seine Deutschkenntnisse für bessere Chancen am Arbeitsmarkt zu erweitern. „Es war das Jahr der Kulturhauptstadt und ich habe Graz in seinem besten Moment gesehen", in dem es etwa auf positive Weise gelungen ist, alte und neue Architektur zu verbinden. Weniger erfreulich blieb ihm das Ausfüllen seines ersten Grazer Meldezettels in Erinnerung: „Ich wurde gefragt, welche Religionszugehörigkeit ich habe. Für mich als Franzose, wo in Frankreich Religion in absolut keinem behördlichen Schreiben vorkommen darf, war das ein Skandal. Ich war schockiert und habe selbstverständlich ‚ohne‘ angekreuzt."
Später lernte er hier seine Frau kennen. „Wir haben zweimal geheiratet. Einmal in Frankreich, da es dort viel einfacher war", und ein zweites Mal traditionell in Weiß in der südoststeirischen Heimatgemeinde seiner Frau.
Nicht (nur) wegen der Liebe bleiben
Da sein Deutsch am Anfang nicht gut war und sein Publizistikstudium ihm hier wenig half, jobbte Damien Crano die ersten Jahre in Österreich in verschiedenen Bereichen, etwa bei der Müllabfuhr in Voitsberg oder im Telefonmarketing für eine Grazer Haarverlängerungsfirma. Von Anfang an war ihm wichtig, darauf zu achten, dass er sein Leben in der Steiermark und in Graz für sich selbst aufbaut, und nicht (nur) wegen der Liebe zu jemandem hier zu sein. Er hat von mehreren Migrant:innen, die wegen der Liebe in Graz geblieben sind, erfahren, dass sie sich hier unwohl gefühlt haben, wenn die Beziehung dann in Brüche gegangen ist.
Aufgrund seiner Französischkenntnisse bekam er schließlich einen Job als Vertreter für französischsprachige Länder eines radiopharmazeutischen österreichischen Unternehmens. Sein großes Ziel blieb es jedoch, „in Österreich einen Job zu machen, der nicht nur mit meiner französischen Sprache zu tun hat. Vor drei Jahren habe ich mit meinem aktuellen Job angefangen und ich dachte: ‚Jetzt fühle ich mich integriert!‘" Sind doch für seine neue Arbeit nunmehr seine selbst erworbenen Kompetenzen, Kenntnisse und Erfahrungen gefragt.
„Ich bin jetzt angekommen und glücklich, etwas geschafft zu haben, denn wenn man in ein anderes Land kommt, ist es schwierig, Fuß zu fassen. Man kennt die Sprache nicht und weiß nicht, wie die nächsten Jahre werden."
„Das" Schaukelstuhl
Neben seiner Arbeit schloss Damien Crano erfolgreich eine Ausbildung zum Lebens- und Sozialberater ab, was ihm viel bedeutet, war doch „das Diplom das erste Dokument, das ich mir wirklich in Österreich verdient hatte". Nachdem er ehrenamtlich beim Kriseninterventionsteam des Landes Steiermark zu arbeiten begann, wurde er 2021 Teil einer kleinen Gruppe von Menschen, die im psychosozialen Bereich tätig sind und die ähnlich dem „Mental Health Café" in München etwas in Graz aufbauen wollten. Da ein Schaukelstuhl für Wohlbefinden und Aufgehobensein steht, war die Idee geboren, den neu gegründeten Verein ‚Das Café Schaukelstuhl‘ zu nennen." Um keine falschen Assoziationen zu wecken, „ließen wir das Wort ‚Café‘ weg und auf die Schnelle schrieb ich ‚Das Schaukelstuhl‘ auf den Flyer. Nach einer Woche fragte mich meine Frau, ob ich nicht wisse, dass der Artikel falsch sei. Ich fragte meine österreichischen Kolleg:innen vom Schaukelstuhl, , warum sie mich nicht darauf hingewiesen hatten. Aber für sie war es okay. So ist ‚Das Schaukelstuhl‘ entstanden und sorgt bei den Leuten für Irritation, aber auch Neugier und Interesse." Wir machen da keine Therapie, aber wir geben die Möglichkeit, einfach zu reden. Einfach vorbeikommen und Dampf ablassen!" Neben der Funktion als niederschwellige psychosoziale Anlaufstelle fungiert man als Stadtteiltreff, wo im Untergeschoß der Peter-Rosegger-Apotheke in der Peter-Rosegger-Straße 101 ehrenamtlich Tätige mit ihren wöchentlichen Aktivitäten Wohlbefinden und psychosoziale Gesundheit fördern.
Immer noch die Angst, nicht richtig verstanden zu werden
Hinsichtlich seiner Erfahrungen als Ausländer beziehungsweise EU-Bürger in Österreich sind Menschen vor allem am Telefon manchmal irritiert, vor allem, wenn sein Akzent für das Gegenüber nicht genau einzuordnen ist. Gibt er sich als Franzose zu erkennen, dann heißt es oft: „Oh, schön!" „Manchmal spüre ich Vorurteile, weil ich nicht perfekt Deutsch kann. Wenn dazu noch Diskriminierungen aufgrund der Hautfarbe oder Herkunft kämen, „das müsste der Horror sein!" So weiß er von einem seiner ehemaligen Arbeitskollegen zu berichten, „der mit Frau und Kind zuerst 10 Jahre in Deutschland gelebt hat und dann nach Graz gezogen ist. Im Kindergarten haben Eltern anderer Kinder schnell gesagt: ‚Spielt nicht mit dem kleinen Mädchen!‘ Das Mädchen hat sehr gelitten. Es hat mich schockiert! Die Familie ging zurück nach Deutschland, wo sie keine solchen Erfahrungen gemacht hatten. Wenn ich besser Deutsch könnte, hätte ich schon öfters Leserbriefe in der Zeitung geschrieben und solche Missstände kritisiert. Aber es gibt auch immer die Angst, missverstanden zu werden.
Keine Doppelstaatsbürgerschaft - „Das ist einfach nur beleidigend"
„Noch nie habe ich mich so verbunden gefühlt mit einer Stadt. Es klingt vielleicht komisch, aber wenn ich etwas brauche: ich weiß, wo ich hingehen muss. Jetzt ist Graz meine Heimat. Heimat ist für mich, wo man sich sicher und aufgehoben fühlt. Graz ist mein persönlicher Wohlfühlort. Hier sind meine Frau, meine Katzen, meine Wohnung."
Obwohl er sich in Graz beheimatet fühlt, ist Damien Crano bis heute Ausländer. „Ich möchte die österreichische Staatsbürgerschaft annehmen, aber meine französische nicht aufgeben! Es ist das Einzige, was ich von meinem Land noch habe! Das sind meine Wurzeln. Ich bin Europäer, ich bin Franzose und ich bin Grazer. Es stört mich sehr, dass man, im Gegensatz zu anderen Ländern, hierkeine Doppelstaatsbürgerschaft haben kann. Nach 20 Jahren hier habe ich das Gefühl, dass ich das Recht haben sollte, hier auf nationaler Ebene zu wählen." Trotzdem gäbe es die Doppelstaatsbürgerschaft meist nur für Sportler:innen oder Opernsänger:innen. „Das ist für mich als Ausländer beleidigend!"
Zum Schluss ist es Damien Crano noch wichtig zu betonen: „Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Menschen in Graz und der Steiermark ihre Heimat gar nicht zu schätzen wissen, dabei haben sie so ein Glück, in dieser wunderschönen Region, im grünen Herzen Österreichs, leben zu dürfen!"



An der Türklingel beim Hauseingang von Hugo Höbel und seiner Ehefrau in der Gradnerstraße findet sich bis heute das alte Puch-Logo mit dem Hinweis: „KFZ Werkstätte Graz-Straßgang". Sie erinnern daran, dass die Geschichte seiner Familie über viele Jahrzehnte eng mit jener des Puch-Unternehmens verbunden war.
Ein erfolgreicher Motorradrennfahrer
Mit großem Stolz erzählt Höbel über seinen Großvater Hugo Höbel (1900-1964), der bereits vor 100 Jahren seine ersten Rennsiege auf einem Puch-Motorrad feierte. „Im Haus hier hängt noch die Urkunde, da er als erster Österreicher beim ‚Großen Preis von Europa‘ in Monza im Jahr 1924 den zweiten Platz belegt hatte." Da er im gleichen Jahr 175-cm³-Vizeeuropameister wurde, rückte das die Grazer Motorradmarke international in den Mittelpunkt. In seiner Rennkarriere, die er 1930 aufgab, gewann Höbel viele Rennen und hatte in ganz Europa für das Puch-Unternehmen positive Werbung gemacht. Alle drei Söhne seines Großvaters, darunter Hugos Vater, „haben bei Puch gelernt und ich auch". Nach dem Zweiten Weltkrieg bekam sein Großvater die Vertretung für die Puch-Werkstätte im Bezirk, zu der auch ein großer Verkaufsraum gehörte.
Transport- und Taxiunternehmer
Während die Puch-Werkstätte nach dem Tod des Großvaters vom jüngsten Sohn übernommen wurde, der am Grundstück eine neue gut gehende Werkstätte aufbaute, baute sein ältester Sohn, Hugos Vater, ein Transportunternehmen auf, an das die noch bestehende Halle in der Gradnerstraße 177b erinnert (sie gehört seit Jahren zum SOS-Kinderdorf, das an diesem Standort Wohngruppen für Mädchen betreibt).
Hugo Höbel, der im November 2023 seinen 76. Geburtstag feierte, besitzt viele erlebnisreiche Erinnerungen an die Zeit, als er über Jahrzehnte als LKW-Fahrer im elterlichen Unternehmen tätig war. So blieb er einmal auf der Ries mit seinem LKW samt Anhänger hängen und verdankte es nur einem anderen LKW-Fahrer, der vorbeikam und Keile einlegte, dass es nicht mit seinem Gefährt unkontrolliert bergab ging. „Da hätte es wohl Tote gegeben! Dann musste ich noch bis zur nächsten Telefonzelle in der Billrothgasse laufen, um den Abschleppdienst zu holen."
Mit der Übernahme des elterlichen Unternehmens verlegte er sich ab 1981 auf Mietautos und den Betrieb von Taxis, „mit denen Studenten in der Stadt fuhren. Aber die haben bei den beiden Wägen Totalschäden verursacht und dann haben wir das aufgegeben." Sein Resümee: „Obwohl ich so viel gearbeitet habe, habe ich bis jetzt nur vom Draufzahlen gelebt und als Unternehmer meine Kinder nicht aufwachsen gesehen." Höbel ist Vater von acht Kindern. Seine erste Frau verstarb 1983 nach kurzer schwerer Krankheit mit 36 Jahren. Bald darauf heiratete er, ein Witwer mit vier kleinen Kindern, seine zweite Frau.
Eine bäuerlich geprägte Straße
Für unser Gespräch nimmt Höbel uns mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte des Bezirks Straßgang. Er hat einige seiner alten Fotografien hervorgekramt, die spannende Einblicke in die großen Veränderungen der letzten Jahrzehnte eröffnen.
Zur Schule hätte Höbel ursprünglich in die viel weiter entfernte Barackenschule in der Hafnerstraße gehen sollen (wo heute ein Spielplatz ist), bevor es dann die nahe alte Volksschule in Straßgang wurde. Es war die Zeit der britischen Besatzungstruppen in Graz „und ich kann mich erinnern, wie ich als Kind in Straßgang die Soldaten marschieren sah, vorne der Sir mit dem Staberl". Zu dieser Zeit gab es noch keinen Kanalanschluss, so wurden die in Fässern gesammelten Fäkalien im eigenen Garten als Dünger verwendet. „Unter dem Dachstuhl gab es einen Fleischhimmel, wo das Geselchte hing und ich manchmal heimlich mit dem Messer hinaufging, um mir ein Stück abzuschneiden", erzählt er lachend. „Dort befanden sich auch die Mehltruhen, wobei man immer wieder die Mehlwürmer aussieben musste."
Ob er dem einstigen, bäuerlich geprägten Straßgang nachweint? „Die Zeiten sind so, was willst du machen? Wie sagt das Sprichwort? Wenn du nicht mit der Zeit gehst, musst du mit der Zeit gehen."
Der alte Bauernhof seiner Familie, der hier einst stand, „war damals eine große Wirtschaft mit rund 45 Hektar", doch 1908 ging dieses strohgedeckte Gebäude aus ungeklärten Gründen in Flammen auf. Danach wurde ein neues Gebäude gebaut, in welchem Herr Höbel mit seiner Frau heute lebt.
Auf einer Fotografie aus den 1960er-Jahren weist er uns auf die einstigen zahlreichen Bauernhöfe in der näheren Umgebung der Gradnerstraße hin, wo jeder dieser Höfe einen Kreuzstadl hatte, „was den Vorteil besaß, dass man mit dem Wagen in den Hof hineinfahren und nach allen vier Seiten abladen konnte. Statt Traktoren benutzten viele zu dieser Zeit Fuhrwerke. Als die Straße hier asphaltiert wurde, durften wir damit nicht hinausfahren, damit keine Kuhfladen auf die Straße kommen." Apropos Fuhrwerk: Auf einem Teil des Areals gegenüber dem Haus der Familie Höbel befand sich einst eine Schottergrube, die in den 1950er-Jahren mit Müll aufgefüllt wurde. Einmal sei ein Mann mit seinem Pferdefuhrwerk beim Abladen zu nahe an den Deponie-Rand gekommen, sodass sein Fuhrwerk samt Pferd in die metertriefe Grube fiel.
Der letzte Bauer in der Umgebung habe erst vor rund fünf Jahren mit der Tierhaltung aufgehört. Einige der Äcker blieben erhalten, während viele verbaut wurden. „Hinter einem Bauernhof wurde eine Siedlung für 150 Wohnungen erbaut." Zum Grund der Familie Höbel gehörten einst ebenfalls größere unverbaute Flächen. „Wir hatten unseren Acker, wo wir Mais, Rüben oder Getreide angebaut hatten und einen großen Obstgarten. Dahinter war alles unverbaut, bis mein Vater den Grund verkaufte, um selbständig zu werden, und dort die heutigen Hochhäuser erbaut wurden."
Am Katzlbach
Ihrem Grundstück entlang floss der Katzlbach, der später unter die Erde verlegt wurde und das Bad Straßgang, das einst ein Ziegelteich war, mit Wasser versorgte. „Dahinter am Katzlbach standen viele Baracken, vor allem für Umsiedler." Im Bereich des heutigen Campingplatzes gab es einen weiteren Teich, den die Brauerei als Eisteich nutzte. „So hatten sie das ganze Jahr Eis. Einmal, als eine Bäuerin verstarb, mussten wir zur Brauerei Eis holen gehen, um es in den Sarg hineinzulegen."
Johann-Höbel-Gasse
Im Jahr 1934 verband sich die Geschichte seiner Familie auf dramatische Weise mit jener des Februar-Aufstandes. „Mein Urgroßvater war Postenkommandant des Gendarmeriepostens in Puntigam, das damals noch ein Teil Straßgangs war." Als dieser mit anderen Gendarmen zum Puntigamer Gemeindeamt kam, wo sich sozialdemokratische Schutzbündler verschanzt hatten, kam es zu einem Schusswechsel, bei dem sein Urgroßvater getötet wurde. In Gedenken an ihn wurde bereits im April 1934 die Viktor-Adler-Gasse in Johann-Höbel-Gasse umbenannt und blieb dies bis zu ihrer Rückbenennung in Adlergasse im Jahr 1947.



Im Jahr 2012 wurde Daniela Grabovac, die seit Jahren mit ihrer Familie in Puntigam lebt, Leiterin der damals neu gegründeten Antidiskriminierungsstelle Steiermark. In ihrem Büro zeigt sie uns all jene Diplomarbeiten von einstigen Studierenden, die zu verschiedenen Aspekten von Diskriminierung entstanden sind und die sie deshalb im Laufe der Jahre mitbetreut hat. Voller Stolz zählt sie auf, wie viele dieser einstigen Studierenden inzwischen selbst im Antidiskriminierungsbereich tätig sind.
Die Rückkehr war bereits geplant
Ihre Eltern, die aus verschiedenen Teilrepubliken des damaligen Jugoslawiens nach Kärnten kamen, lernten sich in der Schuhfabrik Gabor kennen, wo sie beide beschäftigt waren. „Sie haben sich verliebt und ich bin in Kärnten zur Welt gekommen und aufgewachsen." Trotzdem war für sie und ihre Eltern, die in Maribor bereits ein Haus gebaut hatten, immer klar: „Wir sind nur für eine begrenzte Zeit da und kehren zurück." Letztlich war Daniela dafür verantwortlich, dass ihre Familie in Österreich blieb: „Mit sechs Jahren musste ich in Jugoslawien einen Aufnahmetest machen, da man dort in der Regel erst ab sieben in die Schule durfte. Alles hatte gepasst, aber ich wurde trotzdem abgelehnt, weil ich zu klein war." So wurde sie in Kärnten eingeschult und ein Schulwechsel kam nach einem Jahr Unterricht auf Deutsch nicht mehr zustande.
Berufswunsch einer 10-Jährigen: Richterin
In ihrer Volksschule fühlte sie sich jedoch nicht angenommen. „Man gehörte nicht dazu, weil man ein ‚Jugo‘ ist." Zum 10. Oktober, an dem der Volksabstimmung über den Verbleib Kärntens bei Österreich im Jahr 1920 gedacht wird, „wurde mit mir schon in der Volksschule diskutiert", so nach dem Motto: „Wolltet ihr Slowenen unser Land verraten?!" Mit ihrem Familiennamen Grabovac erfuhr sie immer wieder Benachteiligungen, wie etwa bei der Wohnungssuche: „,Ach so, seid ihr Ausländer?!‘ Hat man ‚Ja‘ gesagt, bekam man die Wohnung nicht."
Sie, die bereits in der 4. Klasse Volksschule Richterin werden wollte, half als Jugendliche vielen Migrant:innen, die sie bei Behördengängen begleitete. „Dann kam der Bosnien-Krieg und ich wollte unbedingt als Juristin im Menschenrechtsbereich arbeiten."
„Bis 2007 Ausländerin"
„Ich erzähle das gerne in Workshops, weil vielen Eltern nicht klar ist, was ihre Kinder denken. Jedenfalls hat es mich sehr geärgert, dass meine Eltern nicht Franzosen oder Engländer sind, dann hätte ich in der Schule einen Vorteil gehabt. Ich habe keine Markenkleidung getragen, so kam noch eine soziale Diskriminierung dazu." Auf der Straße war es ihr peinlich, dass ihre Eltern in ihrer Muttersprache redeten: „Ich bin immer drei Meter vor ihnen gegangen, damit man nicht glaubt, dass das meine Eltern sind."
Obwohl in Kärnten geboren und aufgewachsen, hatte sie bis 2007 keine österreichische Staatsbürgerschaft und benötigte daher eine Ausländer:innenbeschäftigungsbewilligung und ein Visum. „Mein Vater sagte einen Satz, der mir im Gedächtnis blieb: ‚Auch wenn ich die österreichische Staatsbürgerschaft habe, ich werde für sie immer ein Ausländer bleiben.‘ Und meine Mutter hat als Slowenin ihren Nationalstolz. So musste ich die Staatsbürgerschaft als Volljährige selbst beantragen. Dafür brauchte ich aber ein bestimmtes Einkommen, das als Studentin nicht gegeben war. Erst als ich genug verdient habe, konnte ich die Staatsbürgerschaft beantragen."
Wie viele Generationen lang hat jemand einen „Migrationshintergrund"?
Wie sinnvoll sieht sie den Begriff des „Migrationshintergrunds"? „Es macht Sinn, wenn es darum geht, wie Menschen durch Migrationsbiografien ihrer Eltern geprägt sind. Aber so wie der Begriff in den letzten 20 Jahren nur defizitär behandelt wird, sehe ich das als sehr bedenklich. Wie weit geht der Begriff, wenn zum Beispiel meine Töchter als eigentlich dritte Generation noch diese Diskussion in der Schule haben. Es fühlen sich Menschen umso weniger beheimatet und willkommen, umso mehr sie über Migration definiert werden. Wenn ich zum Beispiel in der Zeitung lese, wie viele Kinder nicht Deutsch als Muttersprache haben und das gleichgesetzt wird mit fehlenden Deutschkenntnissen", dann verunmöglichen es diese Gruppenkonstruktionen, Menschen individuell zu betrachten und zu behandeln.
Grabovac spricht aus eigener Erfahrung, so wurde ihrer Tochter, obwohl Deutsch eine ihre Muttersprachen ist, wegen ihrer schüchternen Art von einer Logopädin ein Zettel hinterlassen: „Ihr Kind spricht kein Deutsch, bitte dringender Handlungsbedarf!" Dass die Logopädin zu wenig Erfahrung im Umgang mit Mehrsprachigkeit aufwies und diese nicht als Potential und Nutzen, sondern als Defizit gesehen wird, ärgerte Daniela Grabovac sehr. Denn eine solche Einstellung und Bewertung hat ebenfalls Effekte auf die Aufnahme in die Volksschule und weitere Bildungskarriere.
25 Jahre Antidiskriminierungsarbeit
Beginnend mit ihrem Praktikum bei der Anti-Rassismus Hotline von „Helping Hands" im Jahr 1998 und der Gründung von „Helping Hands Graz" als studentische Vereinigung im Jahr 2001 hat sich die studierte Juristin seit nunmehr einem Vierteljahrhundert der Bekämpfung von Diskriminierung verschrieben. Zu ihren größten Errungenschaften zählt sie „die Lokaltests im Jahr 2003, wodurch man sich dem Thema Rassismus bei Lokalen und Diskotheken endlich angenommen hat. Für mich persönlich wichtig war auch die Verleihung des ersten Menschenrechtspreises der Stadt Graz im Jahr 2007." Seit den Anfangszeiten ihrer Arbeit sei das Bewusstsein, was Diskriminierung eigentlich bedeute, stark gestiegen. „Ich kann mich erinnern, vor 25 Jahren wurdest du noch verständnislos angesehen, wenn du über deine Diskriminierungserfahrungen gesprochen hast. Als ‚Gastarbeiterkind‘ habe ich von meinen Eltern immer gehört: ‚Wir sind hier zu Gast, wir beschweren uns nicht!‘ Dagegen sage ich: ,Ich möchte als Mensch behandelt werden!‘"
Mein Lieblingsplatz in Puntigam
„Nachdem wir unsere erste Tochter bekamen, wurde unsere Studentenwohnung in Eggenberg zu klein. Damals baute man in Puntigam geförderte Reihenhäuser mit Kinderspielplätzen, die für Jungfamilien ideal und leistbar waren, auch wenn schon fast am Ende der Stadt gelegen. Wir haben das Glück, dass in unserer Jungfamiliensiedlung fast nur bunt zusammengemischte Familien sind mit vielen binationalen Ehepaaren." Die ältere Tochter besuchte den Kindergarten in Puntigam und „der Kindergarten Nippelgasse war der beste für meine Tochter, sehr multikulti und benachbart mit einem riesigen Spielplatz! Da können die Kinder noch richtig herumtoben. Dieser Spielplatz ist mein Lieblingsort in Puntigam, da er sehr weitläufig und grün ist."