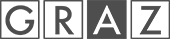Die Stadt Graz setzt verscheidene Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz von Pflanzen und Tieren und zur Förderung der Biodiversität. Stehendes, aber auch liegendes Totholz in den Grazer Wäldern und Grünflächen ist Lebensraum für verschiedenste Insekten wie spezialisierte Käfer und Spinnentiere. Besonders erhaltenswerte Biotopbäume werden mit einer Plakette gekennzeichnet.
Der Wert von Biotopbäumen
Biotopbäume sind Bäume, die aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften und Strukturen eine wichtige Rolle im Ökosystem Wald spielen. Sie sind oft alt, dick und weisen Merkmale wie Stammverletzungen, Rindentaschen, Spechthöhlen oder Greifvogelhorste auf. Diese Bäume bieten Lebensraum für zahlreiche Pflanzen-, Tier- und Pilzarten und tragen somit erheblich zur Biodiversität bei.
Ein Biotopbaum kann beispielsweise eine alte Eiche sein, die über Jahrhunderte hinweg hochspezialisierte Arten beherbergt. Die Rindentaschen und Mulmhöhlen solcher Bäume bieten geschützte Lebensräume für Käfer, Spinnen, Wespen und Wildbienen. Auch Fledermäuse und verschiedene Kleinsäuger nutzen diese Strukturen als Unterschlupf.
Die Bedeutung von Biotopbäumen für die Biodiversität ist enorm. Sie fungieren als Hotspots der Artenvielfalt und tragen zur Vernetzung artenreicher Waldflächen bei. Mindestens zehn Biotopbäume pro Hektar sind notwendig, um eine effektive Vernetzung zu gewährleisten. Diese Bäume sollten daher dringend erhalten und geschützt werden, um die biologische Vielfalt im Wald zu fördern.
Stehendes Totholz ist noch bedeutender als liegendes Totholz
Stehendes Totholz, also abgestorbene Bäume oder Baumteile, die noch aufrecht im Wald stehen, spielt eine entscheidende Rolle für die Biodiversität und die Gesundheit von Wäldern. Es bietet Lebensraum und Nahrung für zahlreiche Arten, darunter Insekten, Pilze, Vögel und Säugetiere. Besonders spezialisierte Arten wie bestimmte Käfer und Pilze sind auf stehendes Totholz angewiesen.
Ein wichtiger Aspekt von stehendem Totholz ist seine Funktion als Kohlenstoffspeicher. Es trägt zur langfristigen Kohlenstoffspeicherung im Wald bei und unterstützt somit den Klimaschutz. Während der Zersetzungsprozesse wird der gespeicherte Kohlenstoff langsam freigesetzt, was zur Stabilität des Kohlenstoffkreislaufs beiträgt.
Stehendes Totholz ist oft seltener als liegendes Totholz, bietet jedoch eine größere Vielfalt an ökologischen Nischen. Es ist daher besonders wertvoll für die Erhaltung der Artenvielfalt im Wald. In Österreich beispielsweise beträgt die durchschnittliche Menge an stehendem Totholz im Ertragswald etwa 9,7 Kubikmeter pro Hektar.
Viele Arten benötigen Totholz
Stehendes Totholz bietet Lebensraum für eine Vielzahl von Arten, die auf diese speziellen Bedingungen angewiesen sind. Hier sind einige Beispiele:
-
Insekten: Viele Käferarten, wie der Eremit (Osmoderma eremita) und der Hirschkäfer (Lucanus cervus), nutzen stehendes Totholz als Brutstätte. Auch verschiedene Wespen- und Fliegenarten finden hier geeignete Lebensräume.
-
Pilze: Holzabbauende Pilze wie der Zunderschwamm (Fomes fomentarius) und der Lackporling (Ganoderma lucidum) zersetzen das Holz und tragen zur Nährstoffrückführung im Wald bei.
-
Vögel: Höhlenbrütende Vögel wie der Buntspecht (Dendrocopos major) und der Waldkauz (Strix aluco) nutzen die Höhlen und Spalten im stehenden Totholz als Nistplätze.
-
Säugetiere: Fledermäuse wie das Große Mausohr (Myotis myotis) und kleine Säugetiere wie der Siebenschläfer (Glis glis) finden in den Hohlräumen Schutz und Unterschlupf.
-
Reptilien und Amphibien: Einige Reptilien und Amphibien nutzen die feuchten und geschützten Bereiche des Totholzes als Versteck und zur Eiablage.
Stehendes Totholz ist somit ein wichtiger Bestandteil des Waldökosystems und trägt erheblich zur Erhaltung der Biodiversität bei.
Der Alpenbock
Der Alpenbock (Rosalia alpina), auch Alpenbockkäfer genannt, ist ein auffälliger und seltener Vertreter der Bockkäferfamilie (Cerambycidae). Er ist vor allem in den Bergregionen Europas, einschließlich der Alpen, beheimatet und steht unter strengem Schutz.
Der Alpenbock zeichnet sich durch seine markante blau-graue Färbung und die schwarzen Flecken auf den Flügeldecken aus. Die Männchen besitzen besonders lange Fühler, die bis zu zweimal so lang wie der Körper sein können.
Der Alpenbock bevorzugt alte, sonnenexponierte Laubwälder, insbesondere solche mit einem hohen Anteil an Buchen. Er ist stark auf Totholz angewiesen, da die Larven sich im Holz entwickeln. Die Käfer sind meist von Juni bis August aktiv und können oft auf gefällten Baumstämmen oder alten Baumstümpfen beobachtet werden.
Als Indikatorart für naturnahe Wälder spielt der Alpenbock eine wichtige Rolle im Ökosystem. Sein Vorkommen weist auf eine hohe Qualität und Vielfalt des Lebensraums hin. Der Schutz und die Förderung von Lebensräumen, die für den Alpenbock geeignet sind, tragen somit auch zur Erhaltung vieler anderer spezialisierter Arten bei.