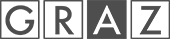In diesem Interview erzählt Dr.in Nicole-Melanie Goll über ihre Arbeit am historischen Bericht zum 100-jährigen Jubiläum, der im Herbst 2017 erscheinen wird, und sie gibt uns Einblicke in Ihre Arbeit.
Seit etwa einem Jahr beschäftigen Sie sich mit dem Thema „100 Jahre Amt für Jugend und Familie" - wie war die Arbeit während der Recherche für den historischen Bericht?
Die Arbeit war aufregend, aber auch herausfordernd. Hundert Jahre sind ein langer Zeitraum und die Zeit war knapp - aber das ist sie ja eigentlich immer so (fügt sie mit einem Lächeln hinzu). Es gibt noch sehr viele Aspekte zu beleuchten und aufzuarbeiten.
Was war denn besonders interessant an der Thematik?
Interessant, aber auch überraschend war, dass sich noch niemand an die Aufarbeitung der Geschichte des „Jugendschutzamtes" herangewagt hat. Die Quellenlage ist sehr gut und Jugend und Familie waren immer schon Teil von Regierungspolitik. Das Spannungsfeld zwischen „Gutes tun" versus „Kontrolle ausüben" ist immer präsent und auch bei der Arbeit am Bericht deutlich zu spüren. Die Fürsorgepolitik ist aber interessant und auch „erforschenswert" - es gibt also noch eine Menge Akten zu wälzen.
Stichwort Akten, Berichte, Zeitzeugen - wie erarbeitet sich eine Historikerin die Geschichte?
Als Historikerin versuche ich, über unterschiedlichste überlieferte Zeugnisse der Vergangenheit die geschichtliche Wirklichkeit zu erschließen. Als Zeithistorikerin liegt der Fokus meiner Arbeit dabei auf der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, man könnte sagen, das Zeitalter der Weltkriege, oder „die Vorgeschichte unserer nahen Vergangenheit". Dabei untersuche ich in meinen Forschungen vor allem menschliche Handlungen und Erfahrungen im jeweiligen historischen Kontext, und dafür ist die Arbeit mit Originalquellen und deren kritische Analyse unverzichtbar. Zur Rekonstruktion der Geschichte des Amts für Jugend und Familie habe ich unterschiedliches Material herangezogen, zum Beispiel schriftliche Quellen der Institution selbst, zeitgenössische Zeitungen, Fotografien, Lebensgeschichten, Statistiken etc.

War diese Arbeit nicht manchmal sehr trocken?
Nein, überhaupt nicht! Man gräbt sich ja nicht nur durch Berge von Akten in Bibliotheken und Grazer Archiven, sondern ist immer wieder mit aktiven und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Institution in Kontakt. Vor allem Vasiliki Argyropoulos hat mir stets neue Einblicke in das Amt gegeben und Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner vermittelt. Sehr in Erinnerung ist mir die ehemalige Leiterin des ärztlichen Dienstes, Dr. Veronika Zobel, geblieben. Frau Dr. Zobel hat sich selbst intensiv mit der Geschichte Ihrer Abteilung auseinander gesetzt und konnte mir mit der einen oder anderen Information, aber auch Anekdote, weiterhelfen.
Anekdote - gab es da vielleicht etwas zum „Schmunzeln"?
Ja, unbedingt - es ist wirklich ein Zufall und bringt mich selbst immer wieder zum Staunen, welche Glücksfälle die Arbeit von Historikerinnen und Historikern erst möglich machen. Frau Zobel hat mir erzählt, dass jahrelang auf dem Dachboden des Gesundheitsamtes alte Glasdiapositiva in irgendeinem Schrank lagerten. Sie hat diese Glasdiapositiva dann vor dem Wegwerfen gerettet und erst jetzt zeigt sich welch unglaublich reicher Schatz an altem Bildmaterial zur Geschichte des Amts und der Abteilung hier gerettet wurde. Einfach unfassbar, dass diese „Zeitzeugen" fast verloren gegangen wären.
Gab es auch Dinge, die Sie nachdenklich oder traurig stimmten - hat Sie etwas sehr berührt?
Besonders schwierige Einzelschicksale konnten aufgrund der Schutzbestimmungen für personenbezogene Akten von mir nicht eingesehen werden. Aber was mich ein wenig nachdenklich stimmte, war und ist die Tatsache, welchen Wandel die österreichische Gesellschaft durchlebt hat und wo diese Reise hin geht. Ein Beispiel dafür ist das Thema „Kinder und Ernährung". Das war und ist immer schon ein große Aufgabe für das Jugendamt gewesen, aber zu Beginn der Kinder- und Jugendwohlfahrt ging es sehr stark darum, die Kinder vor der herrschenden Unterernährung und, ganz hart ausgedrückt, vor dem Verhungern zu bewahren. Heute hingegen hat sich das Bild total gewandelt und es gibt Nahrung im Überfluss - sogar so viel, dass man den Kindern und den Eltern wieder beibringen muss, was gesundes Essen ist, und warum ein Zuviel für sie schädlich ist.

Worauf war man in den Anfängen besonders fokussiert?
Die Gesellschaftsordnung zu Beginn des 20. Jahrhunderts veränderte sich drastisch. Die „Arbeiterschaft" kam auf und änderte radikal althergebrachte Strukturen in den Familien. Die beiden Weltkriege verlangten außerdem, dass auch Frauen arbeiten gehen mussten. Und das änderte natürlich auch die Lebenssituation der Kinder. Die Behörden befürchteten die totale „Verwahrlosung" der Jugend und den „sittlichen Verfall". Zum Teil stimmte es auch, denn die Bedingungen für den Großteil der Bevölkerung waren schlecht. Essen, Gesundheit, Hygiene und Kleidung standen daher im Mittelpunkt der Kinder- und Jugendwohlfahrt. Und man versuchte, die Kinder von der Straße zu holen und sie vor dem Einfluss des Kinos, der „Schundliteratur" und anderen „unpassenden" Vergnügungen zu schützen.
Woher kam diese Angst vor Kino und Schundliteratur? Und wer bestimmte, was gehört, gelesen und gesehen werden durfte?
Die „Behörden" befanden, oft natürlich willkürlich, dass vor allem Detektiv- und Indianergeschichten „entsittlichend" auf die Jugend einwirkten und der ohnehin schon stark zugenommenen Verwahrlosung zugrunde liegen würden. Gleichzeitig gab es zur Zeit des Ersten Weltkrieges und auch in der Nachkriegszeit ein starkes Misstrauen gegenüber der amerikanischen Kultur. Und die immer populärer werdenden Kinos und Schundliteratur, in Form von billig produzierten Heftromanen, waren Ausdruck dieser Kultur und wurden daher auf das Heftigste bekämpft.

Noch eine Frage zum Schluss: Was sind die „Meilensteine" in der Entwicklung des Jugendamtes und kann man Tendenzen erahnen wo die Reise hingeht?
Der wichtigste Meilenstein war die Gründung des „Jugendschutzamtes" in Graz im Jahre 1917 selbst. Denn wie der Name schon besagt, ging es erstmals darum, Kinder und Jugendliche zu schützen und die bisher meist privaten bzw. religiösen Vereine zur Kinderfürsorge zu bündeln und in ein eigenes Amt zu überführen. Es ist beeindruckend was einige wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insbesondere in der Zeit zwischen 1917-1930 geschaffen haben, und wie sie auch um gesetzliche Maßnahmen, also um ein allgemeingültiges Jugendschutzgesetz, gekämpft haben. Ein Name ist hier natürlich besonders wichtig: Dr. Rudolf Glesinger - erster Leiter des Jugendschutzamtes. Er konnte innerhalb weniger Jahre einen Apparat installieren, der zu einem wichtigen Instrument zur Bekämpfung des Jugendelends wurde. Insgesamt hat Glesinger über 36 Jahre lang die Jugendfürsorgeaktivitäten der Stadt Graz entscheidend mitgeprägt.
Sehr erfreulich an den vergangenen Jahrzehnten ist, dass das Amt für Jugend und Familie immer mehr zur Anlaufstelle für Familien wird und für alle möglichen Familienfragen das richtige Service zur Verfügung hat. Die Zeiten der ausschließlichen „Kontrollinstanz Jugendamt" sind vorbei - es geht um Schutz, Hilfe, Kontrolle und um ein Miteinander!
Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind: Im Oktober 2017 wird es die gesamte historische Festschrift mit allen Zahlen, Daten und Fakten zum Nachlesen geben.
Text: Nina Blum